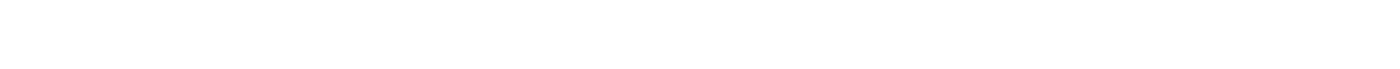… und von schweren Geburten, Performance-Geheimnissen aus den Bergen, ernsten Fristen, vielen Gesetzesvorhaben, einem Bonus zum Managen von Quoten und einem ersehnten Rundschreiben, der großen Freiheit, viel Schlacke und mehr. Die jüngste aba-PK-Tagung war wie stets enorm inhaltsdicht. Claudia Picker und Jan Watermann waren dabei. Teil I eines zweiteiligen Beitrages.
Bonn am Rhein, 1. Oktober, wie stets nach der AR-Tagung findet die diesjährige aba-Pensionskassentagung statt: Jürgen Rings, Leiter der aba-Fachvereinigung Pensionskassen und Vorstandsvorsitzender der Höchster Pensionskasse, begrüßt auch in diesem Jahr die Teilnehmer und beginnt mit einem kurzen Rückblick auf die Tagung zum Aufsichtsrecht für EbAV vom vorherigen Tag sowie einem Ausblick auf die anstehenden Vorträge.

Im Hinblick auf das BRSG II spricht Rings von einer „schweren Geburt“ und weist darauf hin, dass das Säugetier mit der längsten Tragzeit der Afrikanische Elefant mit bis zu 22 Monaten ist – und es bei diesem Gesetzgebungsvorhaben nicht mehr weit dahin ist.
Alle Aussagen wie meist auf PENSIONS●INDUSTRIES im Indikativ der Referenten.
BVV (I): Der Tag der älteren Generation, das BRSG 2.0 …
Zu Beginn beleuchtet dann der Vortrag von Marco Herrmann Aktuelles aus der Gesetzgebung und Rechtsprechung mit Fokus auf Pensionskassen. Der Leiter aba-Fachausschuss Arbeitsrecht und Vorstandsvorsitzender des BVV weist eingangs auf den heutigen „Tag der älteren Generation“ am 1. Oktober hin – ein internationaler Aktionstag, der auf die Situation und die Belange der Älteren aufmerksam machen soll. Herrmann stellt zunächst den Stand des BRSG 2.0 dar und erläutert den Zeitplan und den Kern der Neuregelungen:

Die hohen Anforderungen reduzieren die Anwendungsmöglichkeiten des Opting out auch durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung in der Praxis leider auf ein Minimum. Die Freude über die sinnvollen Änderungen bei der Geringverdienerförderung wird durch die späte Umsetzungsfrist (1. Januar 2027) getrübt.
„Die Evaluierungsfrist bis 2030 ist ernst zu nehmen.“
Im Fokus der Reform stehen für den BVV die Erleichterungen beim SPM, und man freut sich trotz der Wettbewerbssituation über jedes weitere Modell. Die Neuerungen bringen mehr Rechtssicherheit, und auch die weiteren Änderungen des BRSG 2.0 sind sinnvoll und tragen zur Attraktivität der bAV bei.
Herrmanns Fazit, das er aus der aba-Stellungnahme vom 8. August 2025 zitiert, ist jedoch durchwachsen: „Viele gute, manchmal kleine Reformschritte in diesem Entwurf gehen in die richtige Richtung. Auch mit kleinen Schritten kommt man vorwärts. Das stimmt, doch mit größeren kämen wir deutlich schneller ans Ziel.“ Herrmann führt auch noch einmal vor Augen, dass die Evaluierungsfrist bis 2030 unbedingt ernst zu nehmen ist.
… und weitere Gesetzgebungsvorhaben …
Herrmann greift weitere Themen auf: Vom Gesetzentwurf zur Änderung des Verbrauchervertrags- und Versicherungsvertragsgesetzes ist der Kernbereich der bAV mangels im Fernabsatz abgeschlossener „privater“ Verträge erfreulicherweise nicht betroffen, auch wenn Pensionskassen Versicherer im Sinne des VVG sind.
Die Zielsetzung des vorliegenden Gesetzentwurfs zum SGB VI-Anpassungsgesetz, für eine effiziente und moderne Sozialverwaltung das zugrunde liegende Recht klar und digitaltauglich auszugestalten und unnötige bürokratische Vorgaben zu vermeiden, sollte auch auf die Vorschläge für weitere Anpassungen aus Sicht von Pensionskassen Anwendung finden, regt der Jurist an: Die Erweiterung von § 148 Abs. 3 SGB VI und § 69 Abs. 2 Nr. 2 SGB X auf EbAV mit dem Ziel der Beteiligung von EbAV am automatisierten Verfahren zur Übermittlung von Sozialdaten im Rahmen der Anspruchsprüfung für die Zahlung von Betriebsrenten. Dies könnte zu mehr Digitalisierung, Vereinfachungen für Betriebsrentner sowie Kostenersparnis und Beschleunigung der Antragsbearbeitung führen (s. den letzten Vortrag des Tages von Jan Martin Horn in Teil II).
„Die bAV ist als Entgeltbestandteil von der Richtlinie voll umfasst.“
Die vollständige Umsetzung der Entgelttransparenz-RL in nationales Recht muss bis Juni 2026 erfolgen. Im Fokus stehen Informations-, Auskunfts- und Berichtspflichten der Arbeitgeber. Herrmann zeigt bei einem detaillierten Vergleich, dass das deutsche Entgelttransparenzgesetz die diesbezüglichen Vorgaben bisher nicht vollständig erfüllt.
Das federführende BMBFSFJ hat eine Kommission „Bürokratiearme Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie“ eingesetzt, deren Ergebnisse bis Ende Oktober 2025 erwartet werden. Danach soll das Gesetzgebungsverfahren „zügig“ starten. Auf die Arbeitgeber kommt ein straffes Programm zu, weiß Herrmann bereits, denn es müssen – sofern noch nicht geschehen – spätestens jetzt die strukturellen Grundlagen geschaffen und die Vergütungssystematik überarbeitet, Entgeltstrukturen überprüft und ggf. angepasst werden.

Und inwiefern betrifft das die bAV? Sie ist als Entgeltbestandteil zu sehen und von der Richtlinie voll erfasst. Die aba setzt sich für eine sachgemäße Umsetzung ein, jedoch muss man Stand heute von nennenswertem, sehr umfangreichem Anpassungsbedarf ausgehen. Offene Fragen sind dabei u.a. der Wertansatz der bAV in Euro, der Umgang mit Fehlzeiten, die Berücksichtigung von Matching-Beiträgen und die Prüfung und ggf. Anpassung von Versorgungszusagen und Regelwerken versus Bestandsgarantien.
… sowie aktuelle Urteile
Aus gegebenem Anlass blickt Herrmann dann auf einen Verhandlungstermin am 23. Oktober 2025 (BAG, 8 AZR 300/24) mit den passenden Themen: Entgelttransparenz, Höhe des Vergütungsanspruchs, Vergleichsmaßstab und Schadensersatz. Hieraus könnten sich auch noch Impulse für die Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie ergeben (Anm. d.Red: Das Urteil des Achten Senats ist zwischenzeitlich gesprochen, s. die Berichterstattung auf PENSIONS●INDUSTRIES hier und hier).
Arbeitgeberzuschuss bei Entgeltumwandlung: In gleich mehreren Entscheidungen zu § 1a Abs. 1a BetrAVG hat das BAG in diesem Jahr seine Linie bestätigt, dass abweichende tarifvertragliche Regelungen nach § 19 Abs. 1 BetrAVG auch für Tarifverträge, die vor dem 1. Januar 2018 geschlossen worden, zulässig sind. Ob ein Tarifvertrag eine abschließende Regelung und eine von § 1a BetrAVG abweichende Regelung enthält, ist eine Frage seiner Auslegung. Es bedarf hierfür weder einer konkreten oder ausdrücklichen Abbedingung des § 1a Abs. 1a BetrAVG noch einer hierauf bezogenen oder sonstigen Kompensation.
Herrmann begrüßt die Klarstellungen des Dritten Senats, führt es doch zu Rechtssicherheit, auch wenn die Frage, ob im Einzelfall ein Tarifvertrag bereits „abschließend regelnd“ ist, in Zukunft noch die Gerichte beschäftigen könnte.
Escape-Klausel: Im Weiteren erläutert Herrmann die BAG-Entscheidung vom Mai, nach der die Anpassungsprüfungspflicht gemäß § 16 BetrAVG entfällt, wenn sämtliche Überschussanteile ab Rentenbeginn zur Erhöhung der laufenden Leistungen verwendet werden. Neu, wenn auch nicht überraschend, ist die Klarstellung, dass dies unabhängig davon gilt, ob die Pensionskasse zugleich Arbeitgeber ist.
„Schauen Sie Ihre Regelungen durch.“
Der BVV-Vorstand schließt seinen Vortrag mit Hinweisen auf Urteile zu zulässigen Mindestehedauern, der AGG-konformen Ausgestaltung von Späteheklauseln und Ausschlussklauseln bei Hinterbliebenenversorgung. An allen diesen gibt es einen „bunten Zoo“ in den vielfältigen Regelwerken der Praxis zu finden. Herrmann gibt den Zuhörern daher einen Rat mit: „Schauen Sie Ihre Regelungen durch – und die KI könnte Ihnen dabei helfen!“
ZKB: In der Schweiz zum Rendite-Gipfel durch …
Nach den fachlichen Tiefen der Gesetzgebung und Rechtsprechung nimmt Francesca Pitsch von der Zürcher Kantonalbank das Publikum mit an den Fuß des Säntis, einen der markantesten Berge der Schweiz, und richtet den Blick auf seinen Gipfel mit der Frage, wie die Kassen ihr Geld anlegen müssen, um mit ihren Renditen ähnliche Höhen zu erreichen.

Grundlage hierfür ist eine regelmäßig – inzwischen schon zum 25. Mal – durchgeführte Studie zu Schweizer Pensionskassen von Anfang des Jahres, die wohl als umfassendste ihrer Art zu dem Thema gilt und deren Leiterin Pitsch selbst war.
Eingangs erklärt Pitsch kurz das Schweizer Modell der Altersvorsorge: Ähnlich wie in Deutschland besteht es aus drei Säulen: neben der Staatlichen Vorsorge (erste Säule zur Existenzsicherung) und der Privaten Vorsorge (als individuelle Ergänzung die dritte Säule), steht die Berufliche Vorsorge, die den Schwerpunkt auf die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung legt.
Basis dieser im Kapitaldeckungsverfahren finanzierten zweiten Säule ist die obligatorische berufliche Vorsorge (BVG), die gesetzlich vorgegeben ist und im Jahr 2025 eine Mindestverzinsung von 1,25% p.a. vorsieht, sowie die überobligatorische berufliche Vorsorge, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht und entsprechend von jeder Kasse selbst bestimmt werden kann. In diesem Über-Obligatorium sind die Vorgaben zur Kapitalanlage weniger restriktiv.
… den dritten Beitragszahler?
Zahlen zur zweiten Säule in der Schweiz lesen sich relativ zur Größe des Landes beeindruckend; 1.320 Vorsorgeeinrichtungen mit einem vermögensgewichteten Deckungsgrad von 115,9% zu Ende 2024, ungefähr 4,7 Mio. aktive Versicherte und 0,9 Mio. Rentenbezieher.
„Ist die zweite Säule hinsichtlich der Rendite ambitioniert genug?“
An der erwähnten Studie haben hiervon 507 Vorsorgeeinrichtungen teilgenommen, die rund 70% der Versicherten und rund 80% des Vermögens abdecken.
Die erste Frage, die Pitsch aufwirft: Ist die zweite Säule hinsichtlich der Kapitalanlagerendite ambitioniert genug? Genauer: Was wäre, wenn alle Kassen jedes Jahr seit 2008 die jeweilige Top-Performance erreicht hätten? Das Vermögen der Kassen Ende 2024 belief sich auf ca. 1,2 Bio. CHF und setzte sich zu 38% aus Kapitalerträgen und zu 62% aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen zusammen. Dagegen hätte sich – Jahr für Jahr bei jeder Kasse die zu dem jeweiligen Jahr erreichte Top-Performance vorausgesetzt – das Vermögen der Kassen zu Ende 2024 auf ca. 2,1 Bio. CHF mit einer Verteilung von 64% zu 36% belaufen – also eine deutliche Verschiebung zu den Vermögenserträgen als sog. „dritten Beitragszahler“.
Das Top-Secret …
Was unterscheidet also die Anlagestrategien der Kassen? Dafür betrachtet Pitsch die Top-10% der Kassen mit der besten Nettorendite und die der Bottom-10%. Über alle Kassen gesehen gab es in den letzten zehn Jahren keine tektonischen Verschiebungen, was die Asset Allocation anging – der Großteil war in Obligationen, Aktien und Immobilien investiert, jeweils 5 bis 6% in Infrastruktur und alternativen Anlagen sowie in liquide Mittel. Mit diesem Portfolio war es den Kassen möglich, über die letzten zehn Jahre eine durchschnittliche Nettorendite von 3,5% zu erwirtschaften, mit negativen Ausschlägen von –2,9% im Jahr 2018 und –8,8% im Jahr 2022.
Spannend ist hier der Blick auf die oben erwähnten beiden Gruppen: Die Top-10% erreichten 2024 eine Nettorendite von 10,8%, die Bottom-10% eine von 4,8%, und das vor dem Hintergrund einer 7,6%-Nettorendite bei allen Kassen 2024. Was ist nun das Geheimnis der Top-10%?
… lautet mehr Risiko bei weniger Liquidität
Sie schöpfen, so die griffige Aussage der Studie, die Illiquiditätsprämie ab, sie tragen also etwas mehr Risiko bei geringerem Fokus auf Liquidität. Die Top-10% hatten 2024 ein um 136% höheres Investment in alternativen Anlagen und hatten um 46% mehr in Immobilien und um 10% mehr in Aktien investiert. Die Anlagequote in Obligationen hingegen war mehr als halbiert.
Große Renditeunterschiede bei …
Zum Schluss widmet sich Pitsch der Frage nach der Risiko(trag)fähigkeit der Pensionskassen, oder anders gefragt: Welche strukturellen und finanziellen Faktoren erklären, wie viel Risiko eine Pensionskasse eingeht bzw. eingehen kann. Sechs solcher Faktoren hat die Studie identifiziert, die diesbezügliche Auswirkungen haben. Zu zwei von ihnen, der versicherten Lohnsumme und dem Cashflow, lagen keine validen Daten vor – sie bleiben also außen vor. Der dritte Faktor, die Art der Branche (zyklisch oder nicht), war ohne Auswirkung auf die Risikofähigkeit. Der Risikofähigkeit zuträglich ist hingegen ein hoher normierter Deckungsgrad; negativ bemerkbar machte sich ein hoher Teil an Rentnern sowie ein hoher Grad an obligatorischen BVG-Guthaben, für die striktere Anlagevorschriften gelten.
… vergleichbarer Risikofähigkeit
Trotzdem gibt es große Renditeunterschiede bei vergleichbarer Risikofähigkeit, wie Pitsch anhand einer Graphik belegt, die die Risikofähigkeit gegen die durchschnittliche Nettorendite der letzten fünf Jahre zeigt. Beispielhaft werden zwei Kassen mit ähnlicher Risikofähigkeit und ähnlich großem Vorsorgevermögen herausgepickt – eine aus der Gruppe der Top-10%, die andere eine Bottom-10%. Die Top-Performer-Kasse hatte eine Nettorendite von ca. 4,75%, fast 275 Basispunkte mehr als die Bottom-Performer-Kasse – und dies, darauf sei noch mal hingewiesen, bei fast gleicher Risikofähigkeit.
„Top-Performance ist keine Frage der Risikotragfähigkeit.“
Bemerkenswert: dass die Top-Performer-Kasse einen Anteil der obligatorischen BVG von 47% am Gesamtvermögen hatte, der BVG-Anteil bei der anderen Kasse betrug nur 29%; ein Umstand, der sich aus Sicht der Tragfähigkeit eigentlich negativ auswirkt. Wettgemacht wurde das auf den ersten Blick durch einen leicht höheren Deckungsgrad, der Anteil an Rentnern war prozentual identisch.
Schon zuvor hatte Pitsch gezeigt, dass Top-Performance keine Frage der Risikotragfähigkeit ist. Es gibt zwar einen Zusammenhang zwischen der Risikofähigkeit und den tatsächlich eingegangenen Risiken (gemessen an der Volatilität), dies allerdings unabhängig von der erzielten Rendite. Klar ist also: Es muss weitere Faktoren geben, die für die Performance eine Rolle spielen.

Ganz zum Schluss zeigte Pitsch noch, wie sich die jeweilige Anlagestrategie auf die Leistungen der Versicherten auswirkt. In den letzten fünf Jahren haben die Top-Performer die Altersguthaben im Durchschnitt um 4,30% verzinst, die unteren 10% hingegen lediglich um 2,64%. Über alle Kassen betrug die Verzinsung glatte 3,00%.
Somit gilt, wie so oft im Leben: Mut und höhere Ambitionen auf dem Weg zum Pensionskassen-Säntis zahlen sich aus. Der Hebel liegt hier bei der Anlagerendite, die direkte Auswirkung auf die Leistungen hat, schließt Pitsch.
Anm.d.Red.: Falls Sie sich für die Kapitalanlagestrategien schweizerischer Pensionseinrichtungen interessieren, finden Sie mehr Information dazu auf ALTERNATIVES●INDUSTRIES hier sowie in der sich gerade in der Druckerei liegendenHerbst-Ausgabe der kommenden Tactical Advantage Vol 17.
BaFin: Die Sicht der Aufsicht auf die Kapitalanlage …

Im Anschluss unternimmt Romy Ramsay aus dem Grundsatzreferat Kapitalanlage der BaFin einen Exkurs zum Thema „Geänderte Anlageverordnung und Überarbeitung des Kapitalanlagerundschreibens“. Einher damit geht auch das Thema Anpassung des Berichtswesens über die Kapitalanlagen.
Vorweg sei erwähnt, dass das Abkoppeln der Überarbeitung der Anlageverordnung aus dem BRSG 2.0 und deren Umsetzung im Rahmen der „Achten Verordnung zur Änderung von Verordnungen nach dem VAG“ vom 31. Januar 2025 nachhaltige Zustimmung durch die weiteren Referenten sowie das Publikum erfährt.
Der erste Punkt, den Ramsay anbringt, ist die Erweiterung der Öffnungsklausel hinsichtlich Anlagen, die die Streuungsgrenzen nach § 4 Abs. 1 bis 4 AnlV übersteigen. Jedoch, darauf wird explizit hingewiesen, bleibt die Kapazität der Öffnungsklausel insgesamt unverändert bei 5% bzw. 10%. Zudem wird die Risikokapitalanlagenquote um 5% auf nunmehr 40% des Sicherungsvermögens erhöht. Inwieweit der erweiterte Anlagespielraum genutzt wird, bestimmt neben dem Anlage- und Risikomanagement natürlich auch die Risikotragfähigkeit – d.h. auch die Solvabilitätskapitalanforderungen sowie der Stresstest werden hierbei berücksichtigt werden müssen.
„Die Infrastrukturquote bedeutet keine Begrenzung der Anlagen in Infrastruktur auf 5%.“
Kein Bericht zur Änderung der Anlageverordnung kommt ohne das große Thema „Einführung einer Infrastrukturquote in Höhe von 5% des Sicherungsvermögens“ aus:
Infrastrukturinvestitionen müssen nach § 2 Abs. 1 AnlV zulässig sein und der Finanzierung von Infrastrukturanlagen und -unternehmen dienen. Hierunter sind Eigen- und Fremdkapitalinstrumente erfasst. Was daraus direkt folgt, ist eine Entlastung der übrigen Mischungsquoten: Anlagen in Infrastruktur müssen nicht mehr auf die bestehenden Mischungsquoten der AnlV angerechnet werden.
Ramsay weist noch darauf hin, dass die Einführung der Infrastrukturquote keine Begrenzung der Anlagen in Infrastruktur auf 5% bedeutet; vielmehr können diese – je nach dem konkreten Finanzierungsmantel – weiterhin auch in den anderen Mischungsquoten berücksichtigt werden. Wenig befriedigend ist allerdings die nicht vorhandene Definition, was genau unter Infrastruktur zu subsumieren ist. Hier spielt der Aufseher den Ball zu den Kassen, die dies eigenverantwortlich entscheiden und ggf. ihr Vorgehen erklären müssen.
… und bessere Rahmenbedingungen
Dann richtet sich der Blick auf das Standortfördergesetz gemäß Regierungsentwurf vom September 2025, das künftig durch bessere Rahmenbedingungen für mehr private Investitionen sorgen soll. Insbesondere für Investitionen in Infrastruktur und erneuerbare Energien wird dadurch ein erweiterter Anlagespielraum geschaffen.
Der Gesetzentwurf umfasst auch eine Änderung bei Immobilienfonds nach § 2 Abs. 1 Nr. 14c AnlV. Dabei handelt es sich um eine Folgeänderung zur geplanten Änderung des § 231 KAGB hinsichtlich Beteiligungen an Infrastruktur-Projektgesellschaften sowie Gegenständen, die der Bewirtschaftung von erneuerbaren Energien dienen oder für den Betrieb von Ladestationen für Elektromobilität erforderlich sind. Zudem wird klargestellt, dass die in der Verordnung adressierten AIF auch in Liquiditätsanlagen investieren können.
Das ersehnte Rundschreiben
Die Anpassungen der AnlV haben entsprechende Anpassungen des Kapitalanlagerundschreibens zur Folge. Darüber hinaus soll dort klargestellt werden, dass es sich bei Krypto-Werten um immaterielle Vermögenswerte handelt, ferner sind kleinere redaktionelle Anpassungen geplant, und motiviert durch EIOPA sollen Ergänzungen zum Liquiditätsrisikomanagement und der Hinweis mit aufgenommen werden, dass ein holistisches Risikomanagement auch die Nachhaltigkeitsrisiken umfasst. Das Bild der geplanten Änderungen macht der Umstand rund, dass Risiken bei alternativen Kapitalanlagen (wie komplex, heterogen, illiquide ist die Anlage?) deutlicher hervorgehoben werden und sie stärkere Berücksichtigung im Risikomanagement finden sollen. Dabei stellt die Überprüfung des Risikomanagements bei alternativen Kapitalanlagen einen Schwerpunkt der Versicherungsaufsicht für das Jahr 2025 dar.
Derzeit befindet sich das Rundschreiben noch in der Überarbeitung und in der BaFin-internen Abstimmung. Die Konsultation findet dann umgehend im Anschluss statt – ein genauer Zeitplan steht noch aus.
Berichtspflichten aus dem FFF
Ramsay kommt anschließend auch auf die Sammelverfügung vom 19. März 2025 betreffend die Berichtspflichten der VU über ihre Kapitalanlagen zu sprechen. „Aus Nachweisungen werden Formulare“ – die Umstellung der nationalen Berichtspflichten über Kapitalanlagen hinsichtlich der Einreichung im XBRL-Format erfordert jetzt die Formulare F.670.01, F.671.01 und F.660.01. Für 2026 ist die Überarbeitung der Sammelverfügung geplant. Es sollen dann die Änderungen der AnlV mit einbezogen werden sowie die noch ausgebliebene Umstellung auf das XBRL-Format auch für die Anlagen „Fonds“ und „Streuung“ vorgenommen werden.
Angestrebt wird dann auch die Überführung der Sammelverfügung in eine Allgemeinverfügung – was formal bedeutet, dass die BaFin künftig die Kassen nicht mehr einzeln anschreiben muss, sondern die Vorgaben auf der Homepage bekanntgegeben werden. Die Berichterstattung über die Nutzung der neuen Infrastrukturquote kann einstweilen im qualitativen Teil von F.670.01 erfolgen.
BVV (II): Im echten Leben
Den Ball auf nimmt Christian Wolf mit einem Einblick, was aus Sicht der größten Pensionskasse Deutschlands die geänderte AnlV und die Überarbeitung des Rundschreibens bedeuten.
Zuerst erinnert der Risikomanager des BVV das Auditorium daran, dass die Kapitalanlagen bei EbAV zweckgebunden sind, also der Bedeckung der Verpflichtungen dienen, und entsprechend spezifischer Ziele strukturiert werden. Anlagen sollen, und hier blickt er in das Rundschreiben, unter Berücksichtigung der Art der Verbindlichkeiten und des gesamten Risiko- und Ertragsprofils der Anleger mit der gebotenen Sachkenntnis und Sorgfalt verwaltet werden. Um den Verpflichtungen bei Fälligkeit jederzeit nachkommen zu können, ist zudem ein fundiertes ALM eine wesentliche Voraussetzung.
„Investmententscheidungen werden durch andere Faktoren bestimmt.“
Weiter heißt es im Rundschreiben, dass das Maß an benötigter Liquidität von Kasse zu Kasse stark variiert. Das bedeutet insgesamt, dass die Ausnutzung der Anlagemöglichkeiten vom Anlage- und Risikomanagement sowie der Risikotragfähigkeit bestimmt wird.
Vor diesem Hintergrund wagt Wolf die These, dass die neu eingeführte Infrastrukturquote eher als ein „Bonus“ wahrgenommen wird und wohl primär ein „Managen von Quoten“ bedingt – Allokation bzw. Investmententscheidungen werden jedoch durch andere Faktoren bestimmt! Insgesamt, so Wolf, bleibt abzuwarten, ob die AnlV die „große Freiheit“ bringt.
Wie die Alternativen nach Berlin kamen …
Anschließend erläutert Wolf, warum man sich der BVV für den Aufbau eines Portfolios aus alternativen Anlagen entschieden hat. Es sind die gut bekannten Gründe des spezifischen Geschäfts von Pensionskassen: langfristige Verpflichtungen mit geringen bzw. gänzlich ohne Stornorisiken, eine auf Langfristigkeit ausgerichtete Anlagepolitik sowie eine Volatilitätsreduktion und stabile laufende Erträge. Wolf hält mit der nötigen Expertise ausgestattete Pensionskassen für prädestiniert, um hier mitspielen und im Hinblick auf Diversifikation, Ertragsoptimierung, Bewertungsstabilität sowie Inflationsindexierung profitieren zu können.
… und wo ist eigentlich der Ausgang?
Auf jeden Fall sollte der Einsatz von Alternatives eng flankiert werden von einem ALM, einer fundierten SAA sowie einem robust aufgesetzten Neuproduktprozess (NPP). Vor allem muss dabei auch eine Frage geklärt werden, die oft vergessen wird, nämlich, wie man aus Alternatives auch wieder rauskommt. Ebenfalls kurz reißt Wolf an, wie beim BVV Alternatives mit ihren Besonderheiten im Vergleich zu liquiden Anlageklassen im Rahmen der SAA-Analyse, bei der Beurteilung der Risikotragfähigkeit, im operativen Risikomanagement und der Portfoliosteuerung berücksichtigt werden.

Aber, was ist aller Wunsch nach Steuerung von Alternatives ohne valide Daten, den Erfolgsfaktor für laufende Investments? Der BVV greift in seinen Tools bzw. proprietären Templates auf Daten von Cepres zurück. Liegen die Daten vor, so sind die laufende Überwachung sowie das Reporting für „Alternatives“ entscheidend. Neben vielen bekannten Reportings empfiehlt Wolf ein separates Alternative Investment-Reporting unter Einbeziehung des Vorstands, des Asset- und des Risikomanagements, des Rechnungswesens und der Internen Revision. Sollte der gesamte Prozess der „Alternatives“ noch von einem externen Berater begleitet werden, so ist auch hier ein entsprechendes Reporting aufzusetzen.
„Die regulatorische Systematik sollte mehr Raum für die tatsächlichen ökonomischen Risiken lassen.“
Motiviert durch die EIOPA-Opinion zur Beaufsichtigung des Liquiditätsrisikomanagements vom 10. Juli 2025 gibt Wolf auch Einblicke in die Best Practices des Liquiditätsmanagements beim BVV. Als Fazit bleibt, dass viele von den Sorgen, die EIOPA formuliert, auf die deutschen Kassen nicht zutreffen und Liquidität i.A. schon bisher professionell gemanagt wird.
Stresstest bitte anpassen …
Was den BaFin-Stresstest angeht, wiederholt Wolf seine letztjährigen Ausführungen, da unverändert immer noch aktuell: Demnach sollte es der Stresstest als Standardinstrument dennoch erlauben, flexibler auf unternehmensspezifische Besonderheiten einzugehen und die Risikosituation weniger überzeichnen, als dies z.B. 2022 nach dem realisierten Kapitalmarkt- mit einem unverändert hohen Stress-Schock der Fall war.
Zudem sollte die regulatorische Systematik mehr Raum für die tatsächlichen ökonomischen Risiken lassen, indem z.B. die Besonderheiten alternativer Anlagen stärker eingehen. Als weiteren Vorschlag an die BaFin formuliert er, die Konsistenz zu anderen Aufsichtsinstrumenten wie der Prognoserechnung bei einer Anpassung im Blick zu haben, und die kasseninterne Steuerungswirkung des Stresstests nicht zu unterschätzen.
… und die Sache integrierter angehen
Wolfs Fazit: Die Klarstellung aufsichtsrechtlicher Erwartungen ist grundsätzlich zu begrüßen. Offen bleibt der Wunsch, Erkenntnisse aus (oftmals umfangreichen) Sonderabfragen seitens der BaFin regelmäßig zu teilen sowie die Komplexität von Mindestanforderungen nach Möglichkeit nicht zu erhöhen. Weiter wäre wünschenswert, die aufsichtsrechtlichen Instrumente wie die AnlV, das Rundschreiben, den Stresstest sowie das Meldewesen nicht einzeln zu betrachten, sondern deren Zusammenwirken stärker zu beachten. Bei der Infrastruktur sollten die Freiheitsgrade durch Formalien oder enge Definitionen nicht zu stark beschränkt werden. Und wenn man schon dabei ist, dann aufsichtsrechtliche Vorgaben bei der Überarbeitung möglichst „entschlacken“.
Ende des ersten Teils zur Berichterstattung der diesjährigen aba-PK-Tagung. Der zweite folgt in Kürze auf PENSIONS●INDUSTRIES.

Claudia Picker ist Managing Director bei Aon. Jan Watermann ist Senior Consultant bei Aon.
Von Autorinnen und Autoren von Aon erschienen zwischenzeitlich bereits auf PENSIONS●INDUSTRIES:
aba-Pensionskassentagung in Bonn (II): aba-Pensionskassentagung in Bonn (I): Wie Aon mit Innovationen neue Maßstäbe setzt: Better start now: Nachhaltige Benefits in der betrieblichen Vorsorge – bAV meets bKV: aba-Forum Arbeitsrecht (II): aba-Forum Arbeitsrecht (I): Entgelttransparenz-RL vor der nationalen Umsetzung (IV): Kommende Regulierung zu Pay Transparency & Pay Equity: Boomer, ZWK, Flexirente und Hinzuverdienst: aba-Pensionskassentagung 2024 (II): Unternehmen und Menschen im Wandel: 86. aba-Jahrestagung 2024 (VII): aba-Forum Arbeitsrecht 2024 (III): aba-Forum Arbeitsrecht 2024 (II): aba-Forum Arbeitsrecht 2024 (I): Contractual Trust Arrangements: Erfurt bringt Licht ins Dunkel der Invaliditätsversorgung: Anpassungsprüfung und Rententrends: aba-Pensionskassentagung (III): aba-Pensionskassentagung (II): aba-Forum Arbeitsrecht 2023 (II): aba-Forum Arbeitsrecht 2023 (I): Neulich in München – mit Blick nach Erfurt: aba-Pensionskassentagung (III): aba-Pensionskassentagung (II): Entgeltumwandlung und Arbeitsvetrag: aba-Forum Arbeitsrecht 2022 (II): aba-Forum Arbeitsrecht 2022 (I): aba-Pensionskassentagung (II): aba-Pensionskassentagung (I): aba-Forum Arbeitsrecht 2021: Deutschland im Herbst – aba-Pensionskassentagung (III): Deutschland im Herbst – aba-Pensionskassentagung (II): Deutschland im Herbst – aba-Pensionskassentagung (I): Digitale Rentenübersicht: Die EbAV-Regulierung schreitet voran: Aon EbAV-Konferenz 2019: Im September in Köln (III) – aba-Mathetagung 2019: Im September in Köln (II) – aba-Mathetagung 2019: aba-Forum Arbeitsrecht: aba-Mathetagung: Auch das noch (II): aba-Fachforum Arbeitsrecht: EIOPA Stresstest 2017 (III): aba-Tagung Mathematische Sachverständige (II): aba-Tagung Mathematische Sachverständige (I): aba-Forum Arbeitsrecht: BGH zu VBL-Startgutschriften für Rentenferne: Die Steuerbilanz nach den Anpassungen im 253 HGB: Vorlage der EIOPA-Stresstest-Ergebnisse (III):
Von gallischen Dörfern...
Andreas Kopf und Rainer Goldbach, 11. November 2025
Von Elefanten im bunten Zoo …
von Claudia Picker und Jan Watermann, 10. November 2025
Digitale Transformation in der bAV ist ...
von Jochen Pölderl, 6. November 2025
Die Zukunft der Pension Governance
von Lukas Becker, Stephen Finley und Michael Jarczyk, 21. August 2025
With a little Help from my two Friends
von Tanja Löhrke und Angelika Brandl, 16. Juli 2025
50:50 wertgleich?
von Roland Horbrügger, Jan Andersen, Alexandra Steffens und Carsten Hölscher, 2. Juni 2025
1:1 in 100 Tagen?
von Jan Andersen, Alexandra Steffens, Carsten Hölscher und Roland Horbrügger, 26. Mai 2025
Wish you were clear
von Angelika Brandl und Dr. Jan-Carl Stegert, 23. Mai 2025
He worked hard for the Money … but she did no less!
von Gregor Lötsch und Nele Becker, 26. Februar 2025
Keep me workin’ on
von Jan Andersen, 4. Dezember 2024
aba et labora
von Dr. Rainer Goldbach und Andreas Kopf, 8. November 2024
(Wo)Men at Work
von Dr. Rafael Krönung 29. August 2024
Von dünner werdendem Eis …
von Carsten Hölscher und Jochen Pölderl, 1. Juli 2024
Wieviel Rente ist wieviel Geld?
von Jan Andersen, Roland Horbrügger und Florian Große-Allermann, 8. Mai 2024
Einmal – und dann für immer?
von Roland Horbrügger, Jan Andersen und Florian Große-Allermann, 7. Mai 2024
„50 Jahre Betriebsrentengesetz…“
von Jan Andersen, Florian Große-Allermann und Roland Horbrügger, 3. Mai 2024
Warum mehr Aufmerksamkeit gut täte
von Carsten Hölscher, Alexandra Steffens und Pascal Stumpp, 10. April 2024
Die Ausnahme ist nicht die Regel
von Roland Horbrügger und Alexandra Steffens, 14. Februar 2024
Die Anpassung hat Methode
Jan Andersen und Dr. Christian Rasch, 5. Dezember 2023
Abwarten …
von Andreas Kopf, Dr. Rainer Goldbach und Bianca Ermer, 13. November 2023
Funding for nothing?
von Bianca Ermer, Dr. Rainer Goldbach und Andreas Kopf, 6. November 2023
Lieber beim Index bleiben
von Jan Andersen und Roland Horbrügger, 17. August 2023
Der Ruf nach dem Gesetzgeber ...
von Roland Horbrügger und Jan Andersen, 10. August 2023
Leitplanken Made in Erfurt
von Florian Große-Allermann und Roland Horbrügger, 17. April 2023
Mucksmäuschenstill ...
von Tanja Grunert und Ingo Budinger, 18. November 2022
Von Staatsfonds und Stresstest ...
von Andreas Kopf und Dr. Rainer Goldbach, 14. November 2022
Stay in statt Opting out
von Jan Andersen und Roland Horbrügger, 26. August 2022
Wie weit lässt sich die Tür öffnen …
von Roland Horbrügger und Carsten Hölscher, 4. April 2022
Gewisse Skepsis, weniger Strenge
von Carsten Hölscher und Roland Horbrügger, 21. März 2022
Von 3V, VAIT und Großer Koalition
von Matthias Lang, Andreas Kopf und Ingo Budinger, 11. November 2021.
Zwischen zweifelhaft, nicht durchdacht und Kannibalen
von Ingo Budinger, Andreas Kopf und Matthias Lang, 8. November 2021.
Die Operation am offenen Herzen …
von Carsten Hölscher, Alexandra Steffens und Roland Horbrügger, 30. April 2021.
Bier ist bAV…
von Detlef Coßmann, Jan Andersen und Matthias Lang, 6. November 2020.
How to do Insolvenzschutz?
von Detlef Coßmann, Jan Andersen und Matthias Lang, 3. November 2020.
„Das ist nicht hausgemacht“
von Detlef Coßmann, Jan Andersen und Matthias Lang, 2. November 2020.
Auf dem richtigen Weg
von Gundula Dietrich und Dr. André Geilenkothen, 14. September 2020
Von SIPP und EGA
von Wolfram Roddewig, 8. Juni 2020
Von MaGo, ORA, SIPP und mehr...
von Detlef Coßmann, München, 6. Januar 2020
Weniger als Null wird es nicht
von Björn Ricken und Dr. André Geilenkothen, Köln, 27. November 2019
Ein flüchtiges Wesen namens Zins
von Björn Ricken und Dr. André Geilenkothen, Köln, 20. November 2019
Von klein-klein, Textform, Vernachlässigung und mehr…
von Thomas Obenberger, Christine Gessner und Sophia Alfen, München; Mannheim, 30. April 2019
Mathe fast schon magisch
von Dr. André Geilenkothen, Mülheim an der Ruhr, 18. Dezember 2018
Informationsbedürfnis versus zumutbare Beratung
von Gregor Hellkamp und Aida Saip, Mülheim an der Ruhr und München, 11. Dezember 2018
Auf den Punkt gebracht!
von Carsten Hölscher, Mannheim, 30. Mai 2018
Von Bären und Diensten
von Dr. Georg Thurnes, München, 21. Dezember 2017
Von Chancen und Hybriden. Von HFA 30 und vier Vaus.
von Dr. André Geilenkothen, Mannheim, 27. Oktober 2017
Von Rätseln und Mega-Themen.Von Püfferlis und Evergreens.
von Dr. André Geilenkothen, Mannheim, 26. Oktober 2017
Teilentschärfung
von Carsten Hölscher, Mannheim, 5. Mai 2017
Nicht pauschal abziehen!
von Andreas Kasper, München, 8. Juni 2016
Der Staub der Jahrzehnte
von Dr. André Geilenkothen, Mülheim an der Ruhr, 14. März 2016
Von Löchern und Lücken
von Dr. Georg Thurnes, München, 11. Februar 2016