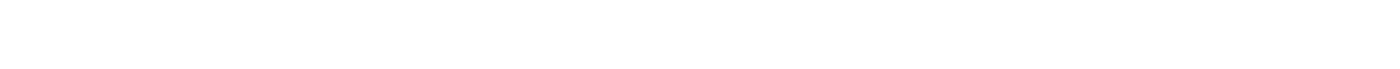Der Streit um die Krankenkassenbeitragspflicht bei Betriebsrenten aus privat fortgeführten Pensionskassen ist mehr als nur eine taktische Einzelfrage. Er ist Symptom eines politischen Defizits im Umgang mit der zweiten Säule. Der vorliegende Beitrag (hier Teil III) ist jüngst als Kommentar in der aktuellen aba-Zeitschrift BetrAV 06/2014 erschienen.

Denn es sind die Rahmenbedingungen, die für die deutsche bAV nicht stimmen, weder auf der Mikro- noch auf der Makroebene, und es ist der eklatante Mangel der Politik an Bewusstsein, welche Rolle eine vom Arbeitgeber unterstützte bAV in einer vergreisenden Industrienation spielen sollte.
Der Autor – Gewerbetreibender und Freiberufler – stellt für sich selbst fest: Wäre er Angestellter, er würde angesichts der gegenwärtigen Gemengelage aus hartnäckigem Niedrigzins, relevanter Kostenbelastung, anhaltender Währungs- und Finanzkrise im staatlichen wie im privaten Sektor, offenkundiger Notwendigkeit hastiger „Reformgesetze“ für die Assekuranz, unabsehbarer Geldmengenausweitung und letztlich überschaubaren Fördertatbeständen (einschließlich der Beitragspflicht in der Rentenphase) jeden Vorschlag des Arbeitgebers zu einer Direktversicherung oder Wettbewerbspensionskasse schlicht ablehnen. Wäre er KMU-Arbeitgeber, würde er seinen Mitarbeitern mit eben diesen Argumenten jede Entgeltumwandlung wegberaten, eine arbeitgeberfinanzierte bAV nicht anbieten und sich so jede Menge an Komplexität, Verwaltung, Haftung und unkalkulierbarer Regulierungs- und Rechtssprechungsperspektive ersparen – komme sie aus Berlin, Brüssel, Kassel, Erfurt oder Karlsruhe. Zugegeben, das ist eine konsequent skeptische Sicht auf die Dinge. Doch ist dies durchaus ein mögliches Denken in erster Linie für Verantwortliche in den derzeit ach so im Fokus der Politik stehenden kleinen und mittleren Unternehmen.
Und die Bundesregierung? Die kann so viele Studien in Auftrag geben, wie sie will. Sie kann auch noch so viel vom Obligatorium andeuten, welches ohnehin am Ende nur die bAV zu einem simplen Faktor der Lohnnebenkosten degradieren würde. Sie mag auch noch so oft beteuern, dass sie die Interessen der deutschen bAV in Brüssel streng vertreten werde (um sich dort dann – Stichwort Mobilitätsrichtlinie – doch vorführen zu lassen). Fazit bleibt: Wenn es ihr nicht gelingt, den dritten Akteur besonders bei KMU nicht mit Zwang oder Druck, sondern mit Attraktivität, zumindest aber mit Verlässlichkeit und Kalkulierbarkeit für die für ihn kerngeschäftsfremde bAV zu gewinnen, wird am Ende nur eines stehen: ein klägliches Scheitern – nicht mehr und nicht weniger. Dass nach dem Kassler Spruch nun nicht zum ersten und wohl nicht zum letzten Male nicht der Gesetzgeber, sondern das Verfassungsgericht im Ping-Pong-Spiel mit höchsten Bundesgerichten für partielle Klarheit wird sorgen müssen, ist da nur eine punktuelle Ausprägung einer übergreifenden Insuffizienz.
Mit einer gesetzlichen Klarstellung, dass zumindest die privat besparten Anteile einer PK-Rente beitragsfrei sind, könnte die Politik einen ersten, ganz bescheidenen Anfang einer Kehrtwende machen. Doch in diesen großkoalitionären Zeiten, in denen die Strategie in der Altersvorsorge anscheinend lautet, Wähler nicht zu überzeugen, sondern sich mit Wohltaten der ersten Säule schlicht zu kaufen, bleibt der Optimismus klein.
Ende des dritten und letzten Teils.