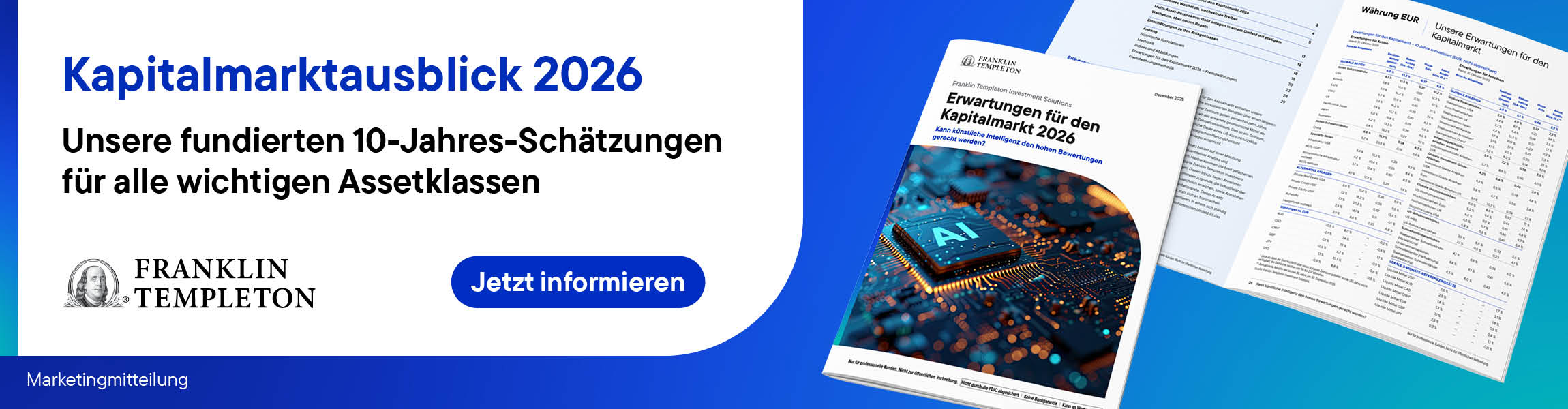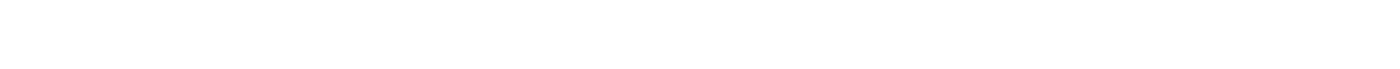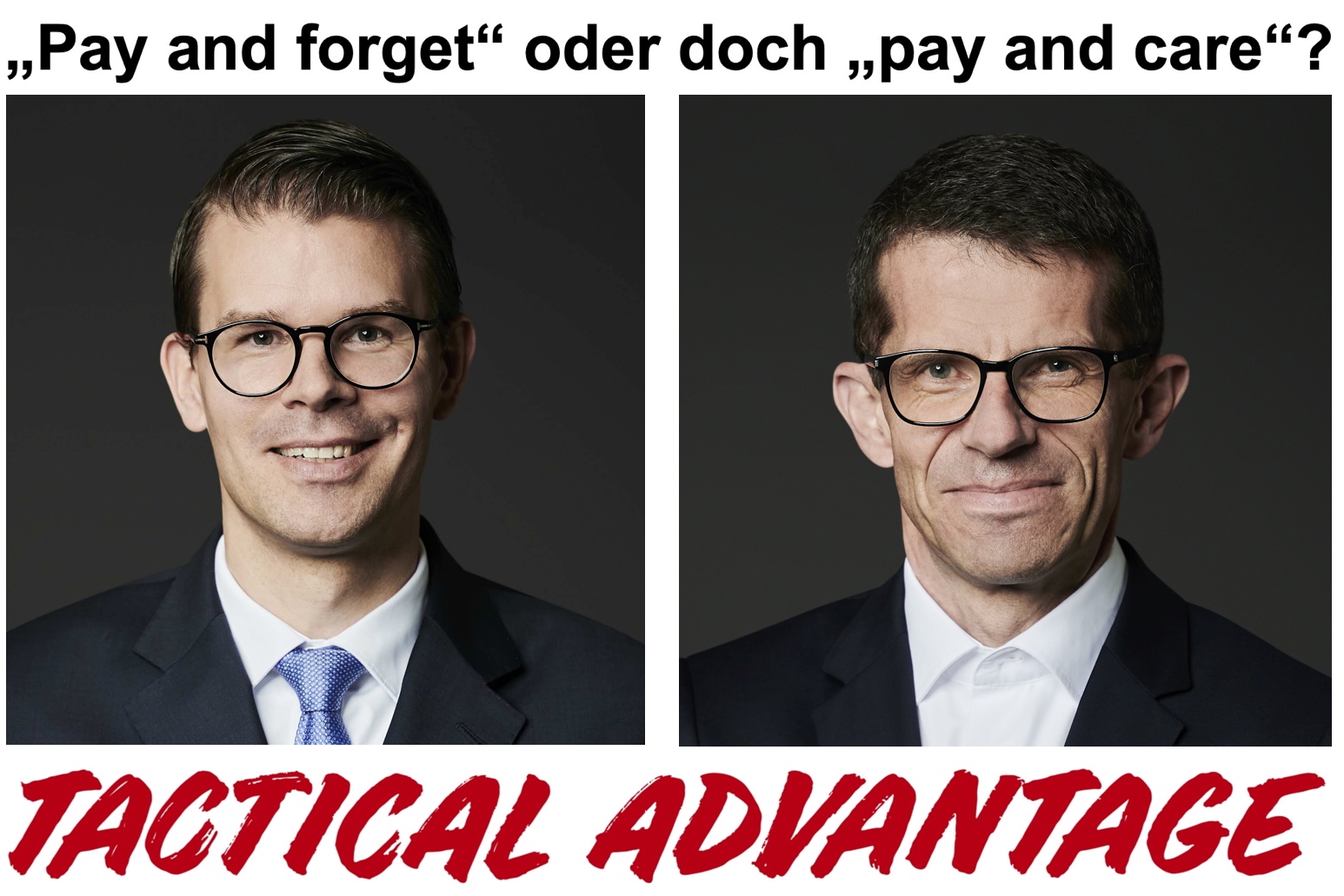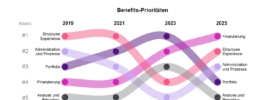Das soll zumindest für die einen Teil der Beteiligten gelten. Neulich am Rhein trafen sich Deutschlands Aktuare, auf der Agenda wie stets auch Pensions: was derzeit im Fokus der Aufsicht steht, wo sich die Kapitaldeckung als Sensibelchen zeigt, wie die Umlage eigentlich heißen müsste, welcher Standard der Rechnungslegung sich als Favorit entpuppt, was künftig regelmäßig statt bedarfsweise erfolgen sollte, wo Corona ein Jahrzehnt ausradiert hat, welche Aktuare KI ersetzten wird und welche nicht – und am Ende geht’s für alle in den Pool. Hanna Lehment war dabei.
Bonn, 28. April bis 30. April, diesjährige Jahrestagung der Deutschen Aktuarvereinigung. Auf der Agenda des dritten Tages die bAV und die Altersvorsorge insgesamt, für die die DAV eine eigene Pensions-Gruppe eingerichtet hat. Diese bietet am dritten Tag mit Vorträgen zu den Themen (Nicht-) Kapitaldeckung und Absicherung von Pensionsrisiken, Sterbetafeln und die Entwicklung des Trends sowie künstlicher Intelligenz im Arbeitsalltag einen breiten wie tiefen Überblick zu den aktuellen Themen der Facharbeit.

Im folgenden einige der Inhalte, dabei alle Aussagen im Indikativ der Referenten:
Funding vs. Jung-zu-Alt

Mit dem Vortrag „Nicht-Kapitaldeckung – Erfahrungen, Überlegungen, Gefühle“ von Christian Wodarg, Partner in der RZP beratenden Aktuare GbR, startet der erste Vortragsblock:
Das Paradoxon einer vollen Kapitaldeckung besteht nach Wodarg darin, dass der tatsächlich benötigte Betrag für eine Leistung erst im Nachhinein final bestimmt werden kann. Individuell kann er unmöglich vorab bestimmt werden, doch der Ausgleich im Kollektiv glättet zumindest die Zahlungsdauer in Richtung des erwarteten Mittelwerts.
„Sensitivitäten zeigen eindrucksvoll den gewaltigen Hebel der Inflation.“
Neben den biometrischen Risiken reagiert die Kapitaldeckung sehr sensibel auf die kapitalmarktnahe Annahmen wie Rechnungszins oder Inflation. Dadurch kann ein hoher Nachfinanzierungsbedarf entstehen, um bei Änderung der Annahmen oder der realisierten Kapitalmarktrendite die Kapitaldeckung weiter sicherzustellen. Besonders die Sicherstellung der realen Leistungshöhe nach Berücksichtigung der inflationsbedingten Geldentwertung muss dabei stärker in den Fokus rücken. Sensitivitäten des notwendigen Finanzierungssatzes von Anwartschaften, die real nicht an Wert verlieren, zeigen eindrucksvoll den gewaltigen Hebel der Parameters Inflation.
Beim Vergleich von kapitalgedeckten und nicht-kapitalgedeckten bzw. umlagefinanzierten Systemen schneidet die Umlagefinanzierung (die aus Sicht von Wodarg korrekterweise eigentlich „Jung-zu-Alt-Finanzierung“ heißen müsste), in einem Umfeld, in der die Inflation größer ist als der Zins, besser ab als eine kapitalgedeckte Finanzierung. Das Kapital, das zur Finanzierung der Leistungen der vorherigen Generation eingesetzt wird, steigt in gleichem Maße wie die Inflation, während das Kapital bei einer Finanzierung über Kapitaldeckung (nur) eine Steigerung in Höhe des Zinses erfährt.
Gleichwertigkeit der beiden Finanzierungssysteme Kapitaldeckung und Nicht-Kapitaldeckung besteht, wenn die Inflation dem Zins entspricht. Dieses Ergebnis hat vor Jahren schon Professor Peter Thullen in seinem Buch „Die Mathematik der sozialen Rentenversicherung unter dynamischen Bedingungen“ hergeleitet – Ergebnisse, die für Wodarg weiter Bestand und Relevanz haben.
HGB vor IFRS
Olaf John, European Client Solutions Director der Legal & General Investment Managers (Europe), beginnt seinen Vortrag „Investmentstrategien zur Absicherung von Pensionsrisiken im Spannungsfeld zwischen HGB und IFRS“ mit einer Umfrage an alle Teilnehmer, welches Anlageziel und welcher Rechnungslegungsstandard für die Steuerung der Kapitalanlage von Pensionsverpflichtungen maßgeblich sein solle. Das für John überraschende Ergebnis der Umfrage ist, dass die Rechnungslegungsvorschriften nach HGB und nicht nach IFRS im Fokus der Bilanzierung stehen sollten.
„Zinsänderungseffekte können nicht durch eine Anlagestrategie gleichzeitig kompensiert werden.“
Die Risiken, die beim Zielfokus „Cashflow“ reduziert werden sollen, sind Inflation und Langlebigkeit; beim Zielfokus „Bilanz“ dagegen kann nur nach einem Rechnungslegungsstandard, IFRS oder HGB, gesteuert werden.

Der Rechnungszins wird nach zwei sehr unterschiedlichen Vorschriften ermittelt, so dass die Zinsänderungseffekte auf die Verpflichtungen nicht durch eine einzelne Anlagestrategie gleichzeitig kompensiert werden können. Daher muss in diesem Spannungsfeld zu Beginn einer De-Risking-Strategie Klarheit über das Hauptziel geschaffen und eine klare Entscheidung zur Priorisierung getroffen werden. Die weiteren Ziele können als Nebenziele mit entsprechend niedrigerer Priorisierung durchaus weiterhin berücksichtigt werden und auch bei gleichwertigen Alternativen für das Hauptziel Entscheidungen erleichtern.
Wichtig ist, dass die Anforderungen und Ziele regelmäßig überprüft werden. Je nach Phase verändert sich die Gewichtung der Ziele; es macht dabei einen deutlichen Unterschied, ob sich ein Portfolio im Stadium des Kapitalaufbaus, der Absicherung oder in der Auszahlungsphase befindet.
Johns Schlussplädoyer: „Man kann auch mit weniger Komplexität mehr erreichen“
Die Liquidität im Aufsichts-Auge

Den ersten Vortragsblock schließt Marius Wenning, Regierungsdirektor im Grundsatzreferat bAV der BaFin, mit einer Einschätzung zum aktuell laufenden EbAV-Stresstest ab:
Die BaFin sieht das Hauptthema des Stresstests, das Liquiditätsmanagement, als ein wesentliches Risiko für EbAV. Die Wahl dieses Stressszenarios war nach einem entsprechenden Stresstest für Versicherer im letzten Jahr wenig überraschend. Wenning hebt die fokussierte Sicht des EIOPA-Stresstests auf einen kurzfristigen Schock auf Marktwerte und Cashflows als sehr positiv hervor. Das Thema ist nicht, wie bei den bisherigen EbAV-Stresstests, eine langfristige Sicht auf die Zeitwertbilanz, sondern – ganz im Sinne des von EIOPA präsentierten Tool-Kits und der Fokussierung – die kurzfristige Reaktion der EbAV bei Eintritt von Liquiditätsrisiken.
Sed Vitae discimus …
Den zweiten Vortragsblock beginnt Thomas Hagemann, Chefaktuar der Mercer Deutschland, mit einer kurzen Vorstellung des neuen Spezialwissensfachs „Rechnungslegung“ in der DAV-Ausbildung. Die Seminare dazu sind in mehrere Module gegliedert, die auch einzeln als Weiterbildung für Mitglieder der DAV, insb. aber auch für IVS-Sachverständige, die im EbAV-Umfeld tätig sind, interessant sind.
Die beiden folgenden Vorträge beschäftigen sich mit dem Thema Sterblichkeiten aus verschiedenen Blickwinkeln.
… und zerlege den Tod

Professor Torsten Kleinow, University of Amsterdam, zeigt seine Beobachtungen zu „Sterblichkeitstrends und sozioökonomische Faktoren aus wissenschaftlicher Sicht“ anhand von zwei Populationen mit unterschiedlichem Sterblichkeitsprofil. Dafür werden beispielhaft Frauen in der Schweiz und Männer in Deutschland betrachtet und die Veränderungen der letzten 30 Jahre analysiert:
In beiden Populationen sind Sterblichkeitsverbesserungen über den gesamten Zeitraum zu erkennen, wenn auch in den letzten Jahre in deutlich geringerem Ausmaß. Hinzu kommt, dass Corona die Verbesserung der letzten 10 Jahre praktisch wieder rückgängig gemacht hat.
„Man kommt an der Zerlegung nach Todesursache nicht vorbei.“
Die daraus folgende Frage ist: Warum geht der Trend der Verbesserung zurück? Dies lässt sich nach Ansicht von Kleinow nur mit einer Zerlegung der Todesursachen analysieren. Datenauswertungen auf der Grundlage des Lee-Carter-Modells, einer statistischen Methode zur Modellierung von Sterblichkeiten anhand verschiedener Einflussgrößen, kommen zu dem Ergebnis, dass insb. Herz-Kreislauf-Erkrankungen den Trend zur Verlängerung der Lebenserwartung sehr stark beeinflusst haben. Als Todesursache gingen sie in den letzten Jahren stark zurück, so dass mittlerweile andere Todesursachen dominieren, die den Trend für die Zukunft bestimmen werden. Kleinows These: „Will man Trends projizieren, kommt man an der Zerlegung nach Todesursache nicht vorbei“.
Die Ausführungen zu sozioökonomischen Effekten mussten zeitbedingt sehr knapp gehalten werden. Sein Fazit in aller Kürze: hohes Einkommen und gute Bildung wirken sich positiv auf die Lebenserwartung aus; und ebenso wirkt auch der Bund der Ehe – zumindest für Männer.

Update des Sterbens noch nicht zwingend
In seinem Bericht aus der Facharbeit des Ausschusses Altersversorgung zu den allgemein anerkannten Sterbetafeln stimmt Friedemann Lucius, Chefaktuar der Heubeck AG, den Beobachtungen von Kleinow zu:
Auswertungen zeigen, dass die einjährigen Sterblichkeitsverbesserungen insb. in den für die Leistungsempfänger relevanten Altersbereichen seit 2011 tendenziell unterhalb der angenommenen Projektivität aus den Richttafeln 2018 G liegen und die tatsächliche Entwicklung insofern hinter der angenommenen Sterblichkeitsverbesserung zurückbleibt.
„Für eine Anpassung sind weitere Beobachtungsjahre erforderlich.“
Da die Corona-Jahre 2020 bis 2022 für eine Trendanalyse problematisch sind und sich auch die künftige Wirkungen von Corona noch nicht verlässlich abschätzen lassen, sind für eine Anpassung der Trendannahmen allerdings weitere Beobachtungsjahre erforderlich. Insofern ist ein Update der Richttafeln 2018 G aus aktuarieller Sicht derzeit (noch) nicht zwingend.

Insgesamt erscheint für die künftige Annahme zur Verbesserung der Sterblichkeiten ein Ansatz argumentierbar, der stärker zwischen Kurzfrist- und Langfristtrend differenziert und den Langfristtrend am Szenario „starker Anstieg der Lebenserwartung“ entsprechend der koordinierten Bevölkerungsvorausberechnungen ausrichtet.
Was die Ausgestaltung des Update-Prozesses betrifft, ist der Ausschuss Altersversorgung der Meinung, dass ein regelmäßiges Update deutliche Vorteile gegenüber der bedarfsweisen Anpassung hat. Neben der besseren Planbarkeit spricht v.a. die Erwartung geringerer Umstellungseffekte für diese Vorgehensweise.
Maschine vor Mensch

Franziska Kühnemund, Senior Director bei WTW, stellt in ihrem Vortrag „Künstliche Intelligenz in der bAV – Smarter verwalten“ die Chancen von KI in der bAV-Verwaltung vor:
Die Pensionierungswelle der Babyboomer bringt gleich zwei Herausforderungen mit sich: Zum einen verstärkt sie den Mangel an Fachkräften, zum anderen müssen viele Neurentner verwaltet werden.
„Die KI darf nur unterstützende Prozesse übernehmen.“
Die Administration der bAV ist stark durch eine Vielzahl von Informationen und Daten getrieben und damit bestens für eine Unterstützung durch Digitalisierung, idealerweise in Kombination mit einer KI geeignet – an der künftig kein Weg vorbei führt. Dabei darf die KI nur unterstützende Prozesse übernehmen, die Verantwortung jedoch darf und kann nicht von der Fachkraft an die Maschine abgeben werden. Eine entsprechende „Ausbildung“ der KI ist auch dafür zwingend notwendig.
Kühnemunds Fazit: „Wir müssen transparenter, schneller und verständlicher werden, um bAV weiterhin attraktiv anbieten zu können.“
Ohne Festlegung in den Pool

Den Abschluss der Pensions-Gruppe bildet ein Praxisbericht aus dem „Pool zur bAV“, den der Ausschuss Altersversorgung der DAV letztes Jahr eingerichtet hat. Alle Aktuare können in dem Pool ihr ehrenamtliches Engagement anhand von ad-hoc-Tätigkeiten oder selbstgewählten Themen einbringen, ohne sich bereits langfristig durch die Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe festzulegen.
Stefan Hämmerle, Senior Consultant bei der viadico GmbH, und Jan Strothmann, Aktuar im Asset-Management bei der Bayer AG, sind Mitglieder dieses Pools und geben mit ihrem Praxisbericht „KI – Konkurrenz für Aktuare?“ einen kurzen Einblick in die konkrete Nutzung von KI im Arbeitsalltag sowie auch in die damit verbundenen Hürden und Risiken:

Das Zählen von Dateien in einer Ordnerstruktur mit Hilfe eines kleinen Makros setzt ChatGPT mit einigen Kontroll- und Korrekturhinweisen schnell und fehlerfrei um. Die Frage nach der korrekten Berechnung von Pensionsverpflichtungen für die Steuerbilanz dagegen kann ChatGPT in diesem Beispiel nicht korrekt beantworten. Interessante Ergänzung am Rande: Gut einen Monat nach dem Vortrag, am 1. Juni, kennt ChatGPT mittlerweile die korrekte Berechnung inklusive korrektem Rechnungszins von 6%.
Anhand dieser (und anderer) Beispiele wird deutlich, dass KI auch für Aktuare als Unterstützung sinnvoll genutzt werden kann, Ergebnisse und Antworten aber nie unreflektiert übernommen werden dürfen – ein zweiter, kritischer Blick ist zwingend notwendig.
Auch diese Beispiele bestätigen die Aussage des ehemaligen IAA-Präsidenten Charles Cowling, die er am Vortag in der Mitgliederversammlung der DAV wiederholt hatte: „KI wird keine Aktuare ersetzen, aber Aktuare mit KI werden Aktuare ohne KI ersetzen.“

Die Autorin ist Aktuarin DAV / IVS und Senior-Beraterin bei der Heubeck AG in Köln.
Von ihr und anderen Autorinnen und Autoren der Heubeck AG sind zwischenzeitlich auf PENSIONS●INDUSTRIES erschienen:
Lifespan, Healthspan, DAV:
Für immer jung?
von Dr. Ursula Finger, 29. Januar 2026
Die Beitragsbemessungsgrenze ab 2027:
Regelbasiert nach oben
von Sebastian Vincke und Marius Jakobs, 12. Dezember 2025
Pensions-Gruppe auf der DAV-Jahrestagung:
In der Ehe länger leben?
von Hanna Lehment, 28. Juli 2025
Die Beitragsbemessungsgrenze ab 2026:
Weiter ganz schön sprunghaft …
von Sebastian Vincke und Marius Jakobs, 8. Mai 2025
Der BFH zu wertpapiergebunden Zusagen:
Von Klatschen und Pflöcken
von Friedemann Lucius, 13. März 2025
Heubeck Kolloquium 2024 – Full House für die bAV:
Es muss nicht immer das Sozialpartnermodell sein ...
von Andrea Riedinger, Silke Seeger und Marcus Müller, 15. November 2024
18. IVS-Forum:
Under-Cover me
von Michael Metzger und Julia Rose, 15. Oktober 2024
Die Beitragsbemessungsgrenze ab 2025 – Jump wie noch nie (II):
Gold im Hochsprung ...
von Marius Jakobs und Dr. Friedemann Lucius, 19. September 2024
Die Beitragsbemessungsgrenze ab 2025:
Jump wie noch nie
von Marius Jakobs und Dr. Friedemann Lucius, 11. September 2024
Wachstumschancen-Gesetz:
Eine Chance für das Wachstum?
von Martin Knappstein und Dmitrij Heimann, 26. April 2024
DAV/DGVFM-Jahrestagung 2023 in Dresden (VI):
Reden wir über unsere Generation
von Katja Jucht und Kai Spier, 17. Juli 2023
Heubeck-Kolloquium 2022:
Von langen Wegen, kurzen Läufern und Alleskönnern
von Martin Knappstein und René Kublank, 22. November 2022
15. IVS-Forum:
Von Widerspruch, Politik und Passgenauigkeit
Dr. Christoph Poplutz und Daniel Fröhn, 4. November 2021
Konkretisierungen aus der Wilhelmstraße:
Klar, unklar, Vorfreude
von Martin Knappstein, 21. September 2021
BAG zur Einstandspflicht des Arbeitgebers:
Abgerechnet wird zum Schluss
von Alexander Bauer, 21. Juli 2020
BAG urteilt zum 16er:
In der Praxis meist erfüllt …
von Alexander Bauer, 26. Mai 2020