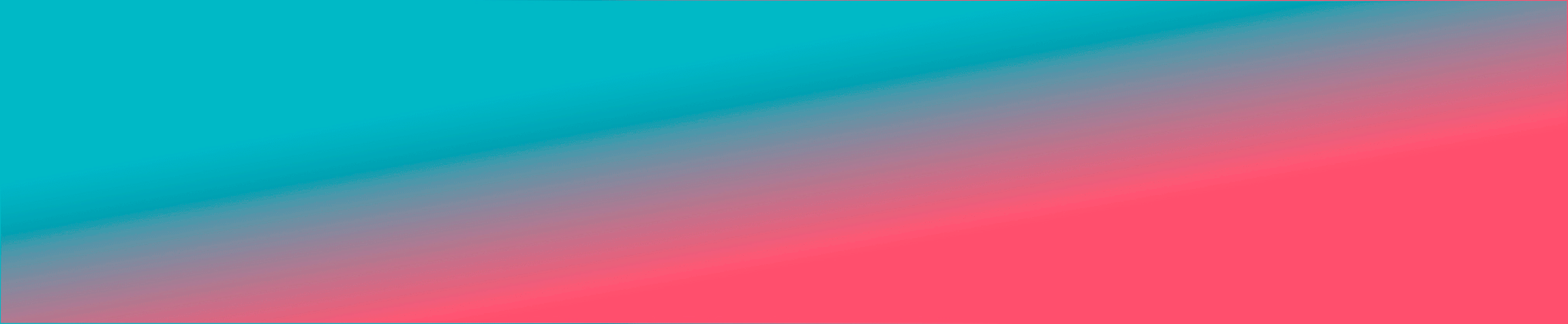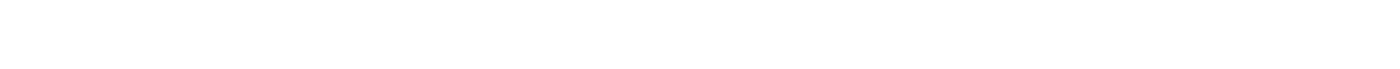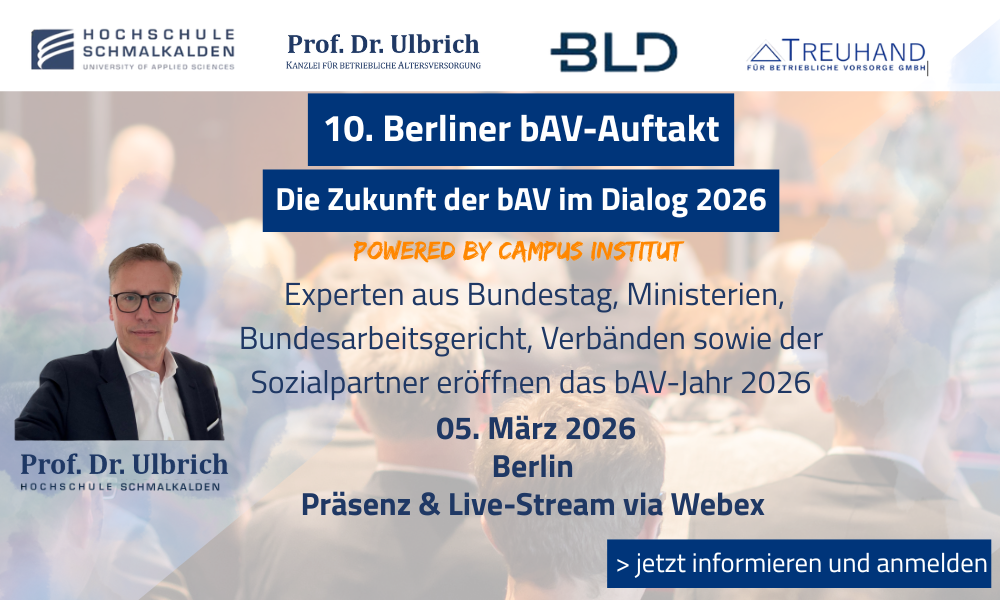Wie berichtet, hat das BMAS den einstigen BRSG-II-Regierungsentwurf aus der vorzeitig gescheiterten Ampelzeit nun praktisch unverändert als neuen Referentenentwurf vorgelegt – was auf eine gewisse Eile hindeutet. SPM, Opting out, Abfindungen, Geringverdienerförderung und mehr: Klaus Friedrich, Lars Hinrichs und Claudia Veh gucken genauer auf das, was sich nichts geändert hat – und gleichermaßen ersehnt wie ausbaufähig ist.
Bundesministerin Bärbel Bas führt auf der Website des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aus:
„Mit dem Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz liegt der nächste wichtige Baustein der Rentenreform vor. Damit wollen wir besonders Betriebsrenten auf tarifvertraglicher Basis weiter stärken, denn diese sind effektiv, kostengünstig und sicher. Kleinen Unternehmen ohne Tarifvertrag werden wir es ermöglichen, sich solchen Systemen anzuschließen, damit sie ihren Mitarbeitenden einfach und unbürokratisch eine Betriebsrente anbieten können. Von der Neuregelung der Förderung profitieren zudem Menschen mit geringeren Einkommen, wozu auch viele Teilzeitkräfte gehören.
Ziel ist es, dass die Betriebsrente ein selbstverständlicher Teil der Alterssicherung wird. Zusammen mit der gesetzlichen Rente, die das Rückgrat unserer Alterssicherung ist und bleibt und die wir ebenfalls stärken werden, haben Beschäftigte somit Aussicht auf ein Alterseinkommen, das ihrem Erwerbseinkommen möglichst nahe kommt.“
Da kann man nur zustimmen. Im Folgenden soll ein Blick auf den aktuellen Stand des Gesetzentwurfs geworfen werden.

Zunächst ist erneut anzumerken, dass es keine nennenswerten inhaltlichen Änderungen im Vergleich zum Regierungsentwurf der Vorgängerregierung aus September 2024 gibt.
1. Unverändert: Klarer Fokus auf Ausbau von SPM
Die in § 24 BetrAVG-E formulierte Stärkung der SPM folgt somit derjenigen aus dem Regierungsentwurf 2024. Grundlage für die Stärkung ist und bleibt eine tarifvertragliche Vereinbarung. Zwischenzeitliche Hinweise der Praxis mit dem Ziel, weiterreichende kollektivrechtliche Vereinbarungen (wie Betriebsvereinbarungen oder Vereinbarungen zwischen anderen Verbänden und ihren Mitgliedsunternehmen) zu ermöglichen, ohne die Tarifautonomie zu untergraben, haben keinen Eingang in die Formulierung des Referentenentwurfs gefunden. Hier denke man insb. an die Branchen/Bereiche der Software-Entwicklung, der Makler, Werbeagenturen oder freien Berufe.
„Hier kommt der Angemessenheit eine große Bedeutung zu.“
Die Beteiligung an der Durchführung der rBZ (SPM) ist für diejenigen Tarifpartner nicht erforderlich, die sich des Instruments des Öffnungs-Tarifvertrags bedienen (vgl. § 21 BetrAVG-E). Allerdings können Dritte von den das SPM tragenden Sozialpartnern zur Beteiligung an den Kosten angemessen herangezogen werden, die diesen im Zusammenhang mit der Durchführung und Steuerung entstehen (vgl. § 24 Abs. 4 BetrAVG-E). Diese Beteiligung kann durch direkte Zahlung an die das SPM tragenden Tarifvertragsparteien erfolgen oder auch durch Einkalkulieren dieser Kosten in die Beiträge durch die durchführende Einrichtung. Auch und gerade hier kommt der Angemessenheit eine große Bedeutung zu. Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen sind zu berücksichtigen.

Mit dem für Sozialpartnermodelle einzigartigen Sicherungsbeitrag nach § 23 Abs. 1 BetrAVG und dessen Erträgen kann eine kollektive, den VB insgesamt zuzuordnende Deckungsrückstellung aufgebaut werden (vgl. § 34 Abs. 3 PFAV). Laut Referentenentwurf sollen unter gewissen Voraussetzungen nun Ertragsspitzen aus der Kapitalanlage diesem Sicherungsbeitragspuffer zugeordnet werden dürfen (vgl. § 35 Abs. 4 PFAV-E). Damit erhält dessen Dotierung, so die Gesetzesbegründung, ein zum Kapitalanlagevolumen proportionales Element. Neben den daraus resultierenden Freiräumen in der Kapitalanlage würde auch nach einer Inanspruchnahme (von Teilen) des Sicherungsbeitragspuffers zur Stabilisierung „der Wiederaufbau der Rückstellung erleichtert“.
2. Keine wirkliche Verbesserung beim Option-out
Bislang ist in § 20 Abs. 2 BetrAVG geregelt, dass auf tarifvertraglicher Grundlage ein Opting out (oder Auto Enrolment) im Rahmen von Betriebs- oder Dienstvereinbarung geregelt werden kann. Diese soll nun auch ohne tarifvertragliche Grundlage möglich sein (vgl. § 20 Abs. 3 BetrAVG-E).
Allerdings lassen zwei der Voraussetzungen erhebliche Zweifel an der Annahme dieser geplanten Neuregelung durch die Praxis aufkommen:
1) Es können nur Entgeltansprüche einbezogen werden, wenn sie „nicht und […] auch nicht üblicherweise in einem einschlägigen Tarifvertrag geregelt“ werden. Das dürfte die Grundmenge der verfügbaren Entgeltanteile signifikant schmälern. Hier erscheint der Referentenentwurf aus dem Jahr 2024 zielführender.
„Die Akzeptanz des Opting out dürfte sich in sehr engen Grenzen halten.“
Und 2): Darüber hinaus muss der Arbeitgeber einen Zuschuss von 20% des umgewandelten Entgelts zahlen – zwar gilt die Verpflichtung des 15%igen Arbeitgeberzuschusses nach § 1a Abs. 1a BetrAVG als erfüllt, aber 20% übersteigen die 15% merklich. Dies dürfte die Akzeptanz des angestrebten Opting out-Mechanismus in sehr engen Grenzen halten, auch unter Berücksichtigung der in der Gesetzesbegründung formulierten Vermutung, „dass solche Optionssysteme möglichst effizient organisiert werden“.
3. Änderung bei § 100 EStG – wie geplant, aber erst später
Die angestrebten und vom Regierungsentwurf 2024 bekannten Neuregelungen des § 100 EStG-E (Geringverdienerförderung) sind grundsätzlich zu begrüßen. Der bAV-Förderbetrag soll von max. 288 auf max. 360 Euro angehoben werden, womit Arbeitgeberbeiträge bis zu maximal 1.200 Euro im Jahr gefördert werden.
Schließlich soll die Einkommensgrenze für Geringverdiener durch Festlegung in Höhe von 3% der gRV-BBG an die Entwicklung genau dieser Bemessungsgrenze und damit an die Gehalts- bzw. Lohnentwicklung gekoppelt werden. Das vermeidet ein „Herauswachsen“ aus der Geringverdienerförderung allein aufgrund der Gehalts- bzw. Lohnentwicklung.

Schließlich sei jedoch angemerkt, dass die hier skizzierte Regelung zur Geringverdienerförderung nun erst zum 1. Januar 2027 in Kraft treten soll.
4. Anmerkungen des Bundesrats bleiben unberücksichtigt
Abschließend verweisen die Autoren dieses Beitrages auf die seinerzeitige Stellungnahme des Bundesrats zum Regierungsentwurf 2024. Der Bundesrat hatte angemerkt, dass ein Förderbetrag in Höhe von 360 Euro zu gering sei (vgl. 3). Darüber hinaus hatte der Bundesrat angeregt, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die Freibeträge zur Sozialversicherung an die Regelungen im EStG angeglichen und somit auf 8% der BBG erhöht werden können. Dies würde die Attraktivität der bAV wirksam erhöhen und Bürokratie abbauen. Beide Hinweise blieben unberücksichtigt.
5. Und darüber hinaus?
Es gibt also keine nennenswerten Änderungen im BetrAVG (außerhalb des SPM), keine Erweiterung der steuerlichen Förderung der bAV (außerhalb von § 100 EStG), jedoch einige Verbesserungen für Pensionskassen:
Die Verdopplung der Abfindungsgrenzen in § 3 BetrAV, sofern der Abfindungsbetrag in die gRV einbezahlt wird, die Erleichterung, Betriebsrente vorgezogen in Anspruch nehmen zu können, auch wenn man die gesetzliche Rente nicht als Vollrente bezieht, sowie einige Erleichterungen in der Kommunikation mit dem PSV sind sicher zu begrüßen, aber kein besonders starker Beschleuniger, um die bAV im erforderlichen Maße nach vorne bringen zu können.
Nach Ansicht der Autoren wäre eine Reduktion der Bürokratieerfordernisse besonders zielführend, also etwa Textform statt Schriftform in den Vorschriften § 4d und § 6 EStG. Ebenso hilfreich wäre eine Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen, insb. eine Anpassung des § 6a EStG-Rechnungszinses und ein Anheben der Leistungshöchstgrenzen in § 2 KStDV.
Positiv und sachgerecht sind sicher die bereits im letztjährigen Regierungsentwurf enthaltene Verbesserung in Sachen Bedeckungsprüfung bei Pensionskassen.
6. Fazit
Alles in allem ein Schritt in die richtige Richtung, der aber noch erweiterungsfähig ist, um die bAV so nach vorne zu bringen, wie es nötig ist, und um die eingangs zitierte Zielsetzung zu erreichen.
Claudia Veh ist Aktuarin und Partnerin der Deloitte B&W GmbH in München.
Lars Hinrichs ist Rechtsanwalt und Partner bei Deloitte Legal in Hamburg
Klaus Friedrich ist Aktuar und Director im Bereich Financial Advisory von Deloitte in Berlin.
Mehr zu dem zur heutigen Headline anregenden Kulturstück findet sich hier.
Von Deloitte-Autorinnen und -Autoren sind zwischenzeitlich bereits auf PENSIONS●INDUSTRIES erschienen:
Neulich vor dem FG Berlin-Brandenburg:
Er sagt mehr als nur hello again
von Dr. Claudia Veh, 23. Februar 2026
Finanzverwaltung und vGA: Doppelte Niederlage statt doppelter Besteuerung:
Don’t you tax me one more time
von Dr. Claudia Veh, 27. Januar 2026
Neulich in Münster:
Split happens
von Dr. Claudia Veh, 29. September 2025
BRSG 2.0 back on Stage (II):
Aus der Wilhelmstraße nicht Neues
von Dr. Claudia Veh, Dr. Klaus Friedrich und Dr. Lars Hinrichs 31. Juli 2025
Neulich in Düsseldorf – GGF-Abfindung und Verzicht mal anders:
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
von Dr. Claudia Veh, 18. Juni 2025
Vom Arbeitsrecht zum Steuerrecht:
Erfurt, Kiel, München
von Dr. Claudia Veh, 22. Mai 2025
Neulich in Köln – der sachliche Geltungsbereich des BetrAVG:
Dreimal Nein am Rhein
von Dr. Claudia Veh und Dr. Lars Hinrichs, 7. April 2025
Von Stuttgart nach München:
Direktzusage, RDV, Verzicht, Pensionsfonds, vGA?
von Dr. Claudia Veh, 17. Februar 2024
Erst Arbeitsgericht, dann Finanzgericht:
Erfurt, Düsseldorf, München
von Dr. Claudia Veh, 21. November 2024
BMF vs. BFH zu GGF-bAV-vGA – Breaking the Case Law (II):
Wer wie was vGA?
von Dr. Claudia Veh, 1. Oktober 2024
BRSG 2.0-E (X) – Spot on SPM:
Die Frage der Einschlägigkeit
von Dr. Klaus Friedrich, Dr. Lars Hinrichs und Dr. Claudia Veh, XX. August 2024
Vergangenen Februar in München:
vGA? Ja. Auflösung der Rückstellung? Nein!
von Dr. Claudia Veh, 31. Juli 2024
Studie zur bAV:
Schnelles Bündel
von Dr. Klaus Friedrich und Dr. Christian Schareck, 19. August 2018