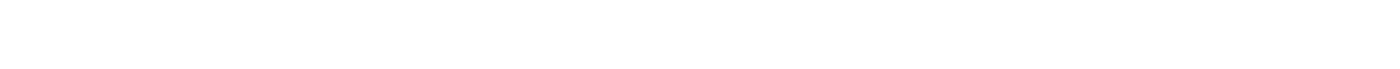Ein ex-GGF, der von seiner zwischenzeitlich bankrott gegangenen GmbH eine üppige Betriebsrente zugesagt bekommen hatte, biss beim PSV auf Granit. Zwei Kölner Gerichte hatten ebensowenig Verständnis für seine Argumentation. Claudia Veh erläutert einen Fall, dessen Wurzeln weit zurückreichen.
Der Pensions-Sicherungs-Verein aG sichert bekanntlich auf Basis der §§ 7 ff. BetrAVG Zusagen auf betriebliche Altersversorgung im Fall der Insolvenz des Arbeitgebers. Dies gilt jedoch nur für Zusagen, die in den Geltungsbereich des BetrAVG fallen. Hierfür ist erforderlich, dass sowohl der persönliche als auch der sachliche Geltungsbereich des BetrAVG erfüllt sind (vgl. PSV-Merkblatt 300/M1).
Persönlich und sachlich
Der persönliche Geltungsbereich wird in einer GmbH regelmäßig an den Stimmrechten bzw. der Beteiligung an der Gesellschaft festgemacht und steht häufiger im Fokus (vgl. z.B. „Weniger, genau oder mehr als 50%?“).

Doch auch der sachliche Geltungsbereich kann im Einzelfall zweifelhaft sein – wie in dem Fall 14 U 4/24, der vom OLG Köln am 25. Februar final entschieden wurde:
Der Fall: Familien-GmbH mit zahlreichen Gesellschaftern
Für den Kläger wurde ab 1992 eine Pensionszusage implementiert, die sich nach einer Wartezeit von fünf Jahren auf eine Alters- und Invalidenrente in Höhe von 60% der durchschnittlichen Bezüge der letzten drei Geschäftsjahre belief. Bei Ausscheiden vor Ablauf der Wartezeit sollte der Rückstellungsbetrag ausgezahlt werden.

Im Jahr 1993 wurde in seinem GF-Anstellungsvertrag geregelt, dass das Ruhegehalt 60% des durchschnittlichen Gehalts und der durchschnittlichen Tantieme der letzten drei Geschäftsjahre betragen sollte. Das Ruhegehalt sollte nicht unter den doppelten Betrag der höchsten Tarifstufe sinken, welche dem Angestelltentarif entsprach. Weiter sollte das Ruhegehalt herabgesetzt werden können, wenn es den vierfachen Betrag dieser Gehaltsstufe überstieg.
Die Anteile an der GmbH verteilten sich auf fünf Familienstämme mit Anteilen zwischen 0,115% und 47,97%, wobei die Beteiligung des Klägers während seiner Dienstzeit vom 1. Januar 1992 bis 30. Juni 2013 zwischen 2% und rund 5% lag.
Am 10. November 1994 wurde der Kläger neben der Geschäftsführer-Tätigkeit für die GmbH noch Geschäftsführer eines Tochterunternehmens der GmbH. 2011 trat der Schwiegersohn eines weiteren Geschäftsführers in die Geschäftsleitung ein. Er erhielt ebenfalls eine Pensionszusage.
Zwischen 1962 und 1969 war in der GmbH ein angestellter, nicht beteiligter und nicht familiär verbundener Geschäftsführer tätig gewesen, der keine Pensionszusage hatte, wohingegen dem Vater des Klägers bereits im Jahr 1957 eine Pensionszusage erteilt worden war. 2011 wurde der Kläger als Geschäftsführer abberufen.
Abberufung, Rechtsstreitigkeiten, Insolvenz – und dann …
Es folgte eine Nichtigkeitsfeststellungsklage, die mit einem Vergleich vor dem LG Detmold endete: Das Geschäftsführer-Anstellungsverhältnis sollte zum 30. Juni 2013 enden. Mit Vollendung des 65.Lebensjahr forderte der Kläger seine Altersrente in Höhe von 10.722,84 Euro monatlich. Die Gesellschaft weigerte sich jedoch, die Rente zu zahlen.
In einem weiteren Rechtsstreit vor dem LG Detmold wurde die GmbH verurteilt, dem Kläger 171.565,44 Euro ausstehende Renten zzgl. Zinsen zu zahlen und ab August 2020 die monatliche Rente zu leisten; die GmbH ging in Berufung.
In der Folge leitete der Kläger die Vollstreckung ein und pfändete die Konten der GmbH. Die Firma ging in die Insolvenz, das Berufungsverfahren wurde ausgesetzt.
… verweigern die Kölner die Übernahme
Der Kläger begehrte nun, dass der PSV in die Pensionsleistungen unter Berücksichtigung der Kappungsgrenze des § 7 Abs. 3 BetrAVG eintritt.
Denn: Es handele sich um eine bAV, die ihm aus Anlass seiner Geschäftsführer-Tätigkeit für die GmbH und das Tochterunternehmen zugesagt worden war. Er argumentierte, dass es auch für andere Arbeitnehmer eine bAV gab und dass die seiner Familie zuzurechnenden Gesellschafter grundsätzlich nicht einheitlich abgestimmt hätten. Zudem sei die Höhe der Zusage für seine Tätigkeit angemessen gewesen, so habe er bei einem vorherigen Arbeitgeber ein deutlich höheres Gehalt bezogen. Die Pensionszusage sei so zu verstehen, dass ihm die volle Leistung nach Erfüllung der Wartezeit zustehen sollte.
Der PSV lehnte jedoch ab. Er war der Meinung, der Anlass für die Zusage sei nicht die Tätigkeit als Geschäftsführer für die GmbH gewesen, sondern weil der Kläger Gesellschafter und mit einem der beiden Gesellschafterstämmen familiär verbunden gewesen ist. Es handele sich also um Unternehmerlohn, wofür die gesetzliche Insolvenzsicherung nicht greife.
Indizien für Unternehmerlohn liegen laut Rechtssprechung vor (vgl. BAG 3 AZR 409/09 und 3 AZR 42/08 vom 19. Januar 2010), wenn:
• nur den Gesellschaftern und deren Familienangehörigen Direktzusagen erteilt worden sind,
• die Zusage ungewöhnlich hoch ist – hier etwa doppelt so hoch wie die damalige BBG in der gRV und
• wenn als Durchführungsweg die Direktzusage gewählt wird, bei der die Belastung des Unternehmens erst in der Rentenphase eintritt.
Mit der Argumentation des PSV war der Kläger nicht einverstanden. Er beschritt den Rechtsweg.
Kein Erfolg beim OLG: persönliche Geltungsbereich erfüllt, aber …
Nachdem der Kläger bereits vor dem LG Köln mit Urteil 24 O 357/22 vom 16. Mai 2024 gescheitert war, hatte er nun auch vor dem OLG keinen Erfolg – denn dieses stellte fest:
Der persönliche Geltungsbereich des BetrAVG erfordert, dass die Tätigkeit des Versorgungsberechtigten für ein (fremdes) Unternehmen erbracht wird (vgl. § 17 Abs. 1 Satz 2 BetrAVG), was impliziert, dass Mehrheitsgesellschafter nicht vom Schutz des BetrAVG erfasst sind. Bei Anteilen unter 10% kann generell keine unternehmerische Leitungsmacht unterstellt werden, was bedeutet, dass bei einer Beteiligung von unter 10% der persönliche Geltungsbereich grundsätzlich als erfüllt gelten kann.
… der sachliche nicht
Doch unabhängig von der unternehmerischen Leitungsmacht ist stets auch der sachliche Geltungsbereich zu prüfen. Denn es besteht kein Insolvenzschutz für Zusagen, die aufgrund einer Unternehmerstellung erteilt wurden. Ebenso wenig geschützt sind Zusagen, die aufgrund verwandtschaftlicher, ehelicher oder freundschaftlicher Gründe erteilt wurden:
Ein Indiz für einen Zusammenhang mit der Gesellschafterstellung liegt, so das OLG, immer dann vor, wenn ein Unternehmen allen Gesellschaftern und nur ihnen ein Versorgungsversprechen erteilt hat.
Bei Familienmitgliedern ist zu untersuchen, ob nur Familienmitglieder oder alle Arbeitnehmer eine Versorgung erhalten haben.
Weiter ist zu fragen, ob die zugesagte Leistung nach Art und Höhe auch bei Fremdkräften wirtschaftlich vernünftig und üblich ist.
Die Darlegungs- und Beweislast für den betrieblich bedingten Anlass der Zusage trägt der Kläger.
Das Ergebnis der Prüfung hat vorliegend ergeben, dass der sachliche Geltungsbereich des BetrAVG nicht erfüllt ist. Die bAV-Zusage des Klägers fällt also nicht in den Schutz des PSV.
Gesamtbildung der Umstände entscheidend
Auch wenn die Beteiligung des Klägers unter 10% lag – d.h. allein aus seiner Gesellschafterstellung nicht abgeleitet werden kann, dass er nicht dem persönlichen Schutzbereich des BetrAVG unterfällt – ergibt das Gesamtbild der Umstände, dass die Zusage aus familiärer Verbundenheit mit einer der Gesellschafterfamilien und seiner eigenen Gesellschafterstellung erteilt wurde. Schon sein Vater gehörte zu einem der „großen“ Familienstämme; zusammen mit einem weiteren Gesellschafter hielt der Familienstamm seit 1978 über 50% der Anteile.
Die Gesellschafterstellung allein war zwar kein maßgebliches Kriterium für die Pensionszusage, aber zumindest ein relevantes und damit ein Baustein für die notwendig zu treffende Gesamtabwägung, so das Gericht. Für die vom Kläger angeführten 13 anderen Mitarbeiter mit einer bAV bestanden deutlich niedrigere Direktversicherungszusagen, die nicht mit einer Direktzusage gleichgesetzt werden konnten.
Dass zudem für den nicht mit der Familie und der Gesellschaft verbundene Fremd-Geschäftsführer, der von 1962 bis 1969 im Unternehmen tätig war, keine Pensionszusage bestanden hat, bekräftigt zudem, dass der Kläger die Zusage aufgrund der Gesellschafterstellung und der familiären Verbundenheit erhalten hat.

Zudem erschien dem Gericht ein Ruhegehalt, das 70% höher war als sein letztes reguläres Gehalt, nicht mit dem Versorgungszweck einer Zusage vereinbar.
Damit ist der Kläger mit seinem Begehren gescheitert. Da die Revision nicht zugelassen war, dürfte ihm nur geblieben sein, seine Ansprüche beim Insolvenzverwalter zur Insolvenztabelle anzumelden.
Fazit
Das Urteil des OLG macht erneut bewusst, dass bei der Prüfung des Geltungsbereichs des BetrAVG nicht nur isoliert auf den persönlichen Geltungsbereich zu achten ist, sondern stets auch die Frage gestellt werden muss, ob der Versorgungsberechtigte die bAV-Zusage aufgrund seiner Tätigkeit für die Gesellschaft und nicht aufgrund seiner Gesellschafterstellung oder aufgrund familiärer Verbundenheit erhält.
Nur wenn die Zusage nicht aus Anlass der Gesellschafterstellung und nicht aufgrund familiärer Verbundenheit erteilt worden ist, dann ist die Zusage über den PSV insolvenzgesichert.
Claudia Veh ist Aktuarin und Partnerin der B&W Deloitte GmbH in München.
Lars Hinrichs ist Rechtsanwalt und Partner bei Deloitte Legal in Hamburg.
Von Deloitte-Autorinnen und -Autoren sind zwischenzeitlich bereits auf PENSIONS●INDUSTRIES erschienen:
Neulich in Düsseldorf – GGF-Abfindung und Verzicht mal anders:
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
von Dr. Claudia Veh, 18. Juni 2025
Vom Arbeitsrecht zum Steuerrecht:
Erfurt, Kiel, München
von Dr. Claudia Veh, 22. Mai 2025
Neulich in Köln – der sachliche Geltungsbereich des BetrAVG:
Dreimal Nein am Rhein
von Dr. Claudia Veh und Dr. Lars Hinrichs, 7. April 2025
Von Stuttgart nach München:
Direktzusage, RDV, Verzicht, Pensionsfonds, vGA?
von Dr. Claudia Veh, 17. Februar 2024
Erst Arbeitsgericht, dann Finanzgericht:
Erfurt, Düsseldorf, München
von Dr. Claudia Veh, 21. November 2024
BMF vs. BFH zu GGF-bAV-vGA – Breaking the Case Law (II):
Wer wie was vGA?
von Dr. Claudia Veh, 1. Oktober 2024
BRSG 2.0-E (X) – Spot on SPM:
Die Frage der Einschlägigkeit
von Dr. Klaus Friedrich, Dr. Lars Hinrichs und Dr. Claudia Veh, XX. August 2024
Vergangenen Februar in München:
vGA? Ja. Auflösung der Rückstellung? Nein!
von Dr. Claudia Veh, 31. Juli 2024
Studie zur bAV:
Schnelles Bündel
von Dr. Klaus Friedrich und Dr. Christian Schareck, 19. August 2018