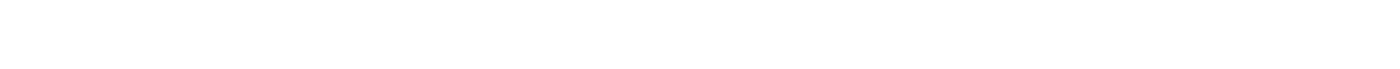Auf dem neulichen Symposium in der Kölner Flora wurde nicht nur das Jubiläum des Insolvenzschutzes der deutschen bAV begangen, sondern es gab auch Inhalt – und das nicht zu knapp: über rentenpolitische Stellschrauben, drei Thesen, das faktisch schon bestehende Obligatorium, nicht so üppige Renten, keine verlorenen Jahre, Zurückhaltung infolge fehlender Garantien und viel mehr … Marina Stürmer war dabei.
Köln, 7. Oktober: Der Pensions-Sicherungs-Verein VVaG feiert sein 50-jähriges Bestehen im Festsaal der Flora in Köln im Rahmen eines Symposiums (Foto Impressionen s. hier).
Unter den etwa 250 Gästen befinden sich viele auf dem Parkett bekannte Freunde der bAV aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, aber auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des PSVaG.
Prof. Gregor Thüsing, Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit der Universität Bonn, übernimmt die Moderation der bis in den Nachmittag reichenden Veranstaltung und führt mit gezielten Fragen durch die Podiumsdiskussionen (alle folgenden Aussagen wie stets auf PENSIONS●INDUSTRIES im Indikativ der Referenten):
Die Rücksichtslosigkeit gegenüber der Jugend
Teil des Vormittagsprogramms ist zunächst die Ansprache von Ingo Kramer, Aufsichtsratsvorsitzender des PSVaG und Ehrenpräsident der BDA. Er gratuliert dem PSVaG für ein halbes Jahrhundert Sicherheit und Solidarität für die bAV. Kritisch blickt er auf die aktuellen Entwicklungen:

Jede Reform der jüngeren Vergangenheit zeugt von einem hohen Maß an Rücksichtslosigkeit seiner Generation gegenüber der Jugend. Die generationsgerechte Lösung des ökonomischen Widerspruchs zwischen Leistungsversprechen und Finanzierung sieht Kramer in dem gleichzeitigen Drehen an allen drei rentenpolitischen Stellschrauben: Beitragssatz, Rentenniveau und Renteneintrittsalter. So könnten Anreize zum längerem Arbeiten für das eine Drittel der Bevölkerung geschaffen werden, das nach einer aktuellen Studie über die Regelarbeitszeit hinaus arbeiten will.
„Die Begrenzung der Sozialversicherungsbeiträge sichert die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft.“
Eine zusätzliche Kapitaldeckung im Rentensystem wie auch bei der privaten Vorsorge könnte mit Anreizen und richtiger Aufklärung geschaffen werden. Die Begrenzung der Sozialversicherungsbeiträge auf 40% sichere die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft in der Generation seiner Kinder, so Kramer, der mit einem Überblick über die jetzt fünf Jahrzehnte füllende Geschichte und die (bewältigten) Herausforderungen für den PSVaG schließt.
Die Mitverantwortung für ein Fünftel der Bevölkerung
Das Wort übernimmt der Staatssekretär im BMAS, Rolf Schmachtenberg, der kurzfristig den eigentlich angekündigten Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, vertritt und einige Zahlen zur gesetzlichen Insolvenzsicherung nennt: Der PSVaG trägt für ein Fünftel der Bevölkerung die Mitverantwortung für ein Einkommen im Alter!

Gegenüber seinem Vorredner und anderen Kritikern verteidigt Schmachtenberg die aktuellen Gesetzgebungsvorhaben: das Rentenpaket II mit der Sicherung des künftigen Leistungsniveaus der gesetzlichen Rentenversicherung und deren Einstieg in Kapitaldeckung, zeitgleich das Zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz für die Weiterentwicklung der bAV sowie der aktuelle Gesetzesentwurf des BMF zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge.
„Die gesetzlichen Renten sind in Deutschland im internationalen Vergleich nicht üppig.“
Sein Vorredner, so der Staatssekretär, verkennt mit Blick auf die Generationengerechtigkeit, dass die gesetzlichen Renten in Deutschland im internationalen Vergleich nicht üppig sind. Bei der Festschreibung auf 48% geht es um eine leichte Korrektur, sonst würde das Rentenniveau weiter abnehmen. Alternative Lösungen wären noch teurer für die jüngeren Generationen.
Das BRSG II sieht Schmachtenberg auf einem guten Pfad mit der Öffnung des Sozialpartnermodells für Tarifungebundene und der Andockungsmöglichkeit anderer Tarifvertragsparteien an bestehende Modelle zur Schaffung einiger weniger machtvollen Modelle als große Kapitalsammelstellen und der Verbesserungen in der Niedrigverdienerförderung. Es geht Schmachtenberg nicht um Revolution, sondern um Evolution.
Drei Thesen zur Diskussion gestellt …
Die erste Podiumsdiskussion zum Thema „Rahmenbedingungen für die bAV verbessern – weiterer Handlungsbedarf“ leitet Benedikt Köster, Vorstandsmitglied des PSVaG, ein.

Hierzu zeigt er zunächst die u.a. aus der demographischen Entwicklung folgenden Probleme des deutschen Rentensystems auf. Als drei Ziele für die bAV nennt Köster auskömmliche Alterseinkünfte, gerechte und zielführende Rahmenbedingungen und dauerhafte Finanzierbarkeit. Er stellt drei Thesen zur Erreichung dieser Ziele auf:
1. Da die gRV das Mindestziel von auskömmlichen Alterseinkünften nicht erreicht, sind kollektive und kapitalgedeckte Systeme der bAV eine nachhaltige und risikoausgleichende Ergänzung zum Umlageverfahren.
2. Weil das Ob einer Zusage auf bAV von ungerechten soziodemographischen Faktoren abhängt wie Gehalt, Bildungsgrad etc., sind einfache, niederschwellige (obligatorische) Opting out-Modelle einzuführen.
3. Zur dauerhaften Finanzierbarkeit muss eine veränderte Rentenbezugsdauer mit einem veränderten Renteneintrittsalter einhergehen.
… und die Frage nach der Lösung
Über diese Thesen diskutieren dann Susanna Adelhardt (Vorstandssprecherin der Heubeck AG und Aufsichtsrat PSVaG), Christian Gleimann (Senior Vice President Group HR/Executive HR E.ON SE, Vorstandsvorsitzender VAEU und Aufsichtsrat PSVaG), Rolf Schmachtenberg (beamteter StS im BMAS), Judith Kerschbaumer (Leiterin Bereich Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik und Referentin Alterssicherungspolitik ver.di) sowie Prof. Fred Wagner (Vorstand Institut für Versicherungswissenschaften Universität Leipzig und Verwaltungsratsmitglied BaFin).
„Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters ist keine gerechte Lösung.“
Fred Wagner sieht die zwei substantiellen Lösungen zur Finanzierung der gRV in der Verlängerung der Lebensarbeitszeit und in gezielter Migration. In der Erhöhung des Renteneintrittsalters sieht Kerschbaumer keine gerechte Lösung. Damit würde alles auf den Arbeitnehmer abgeladen. Ihre Antworten sind Bundeszuschüsse und höhere Sozialabgaben.
„Menschen müssen länger gesund bleiben.“
Rolf Schmachtenberg hält nicht die Erhöhung des Renteneintrittsalters, sondern die tatsächliche Lebensarbeitszeit durch Förderung der (psychischen) Gesundheit der Menschen für die Lösung. Menschen müssen länger gesund bleiben, da die Überbrückung bis zu einer gehobenen Regelaltersgrenze durch Erwerbsminderungsrente volkswirtschaftlich teuer ist. Migration findet er ebenso erforderlich: Die Fachkräfteeinwanderung wird daher gefördert durch die gesetzliche Neuregelung der Anerkennungspartnerschaft, erläutert der Spitzenbeamte.

Christian Gleimann meint, es sollten aber auch die Potenziale im Land ausgeschöpft werden: von Frauen und Älteren. Soziale Abgaben sind ein Standortfaktor, daher ist deren Anhebung für Arbeitgeber für ihn keine Lösung. Die Anhebung der Regelaltersgrenze ist notwendig, so der HR-Experte.
Die Arbeitgeber und die reine Beitragszusage
Sozialpartnermodelle halten grundsätzlich alle Diskutanten für einen guten Weg. Susanna Adelhardt führt aus, dass nur im Kollektiv Absicherung möglich ist. Einen noch offeneren Zugang zu bestehenden Sozialpartnermodellen – auch im Organisationsbereich anderer Gewerkschaften, wenn die eigene kein Sozialpartnermodell bereitstellt (wie die IG Metall) – für kleine und mittelgroße Unternehmen hält Gleimann für sinnvoll. Jedoch: Judith Kerschbaumer, die mehr „gute“ bAV für die unteren Einkommensbereiche fordert, hat hierbei Vorbehalte: die Arbeitgeber müssten dann auch bereit sein, selbst Geld (mindestens die Hälfte) in die bAV der Arbeitnehmer zu investieren; Sozialpartnermodelle mit reiner Entgeltumwandlung sind keine „gute“ bAV.
„Arbeitgeber sind trotz des Wegfalls der Garantien bei Sozialpartnermodellen zurückhaltend.“
Wagner stellt fest, dass Arbeitgeber trotz des Wegfalls der Garantien bei Sozialpartnermodellen zurückhaltend sind. Die Arbeitgeber wollen zwar keine Garantien mehr geben, dies aber auch nicht gegenüber dem Arbeitnehmer vertreten. Wenn die Rente niedriger als erwartet ausfällt, sehen sich die Arbeitgeber in einer moralischen Haftung, weil der Wertverlust sonst negativ auf sie zurückfällt, so der Professor.
Zwischen Opting out und Obligatorium
Opting out-Modelle hält Gleimann für sinnvoll, ein Obligatorium allerdings für zu weitgehend. Wagner sieht das Dilemma, dass Geringverdiener die bAV nicht finanzieren können, sie allerdings nur durch Arbeitgeber finanzieren zu lassen, schwächt wiederum den Standort Deutschland.
„Im Grunde gibt es schon ein Obligatorium.“
Adelhardt meint, dass es ein Obligatorium mit dem Anspruch der Arbeitnehmer auf Entgeltumwandlung im Grunde schon gibt. Die Kommunikation mit dem Arbeitnehmer hält sie für wichtiger als Opting out-Modelle. Es bedarf einfacher Wege sowie Aufklärung, so dass jeder Arbeitnehmer selbst über seine bAV entscheiden kann, so die Aktuarin, die die Herausforderung darin sieht, eine einfache Kommunikation zu schaffen – ohne Risiko für den Arbeitgeber –, um Wertschätzung beim Arbeitnehmer für bAV zu erreichen.
Man ist eigentlich auf einem ganz guten Pfad, sagt Schmachtenberg zur Frage des Obligatoriums. Seit Einführung des Sozialpartnermodells hat es eine lange Zeit des Lernens gegeben. Für den Fall, dass das BRSG II die dazu bestehenden Hemmnisse nicht abbauen kann, kündigt es eine Evaluation an. Die Kritik an diesem Vorgehen als „verlorene Jahre“, teilt Schmachtenberg nicht. Der gesetzliche Auftrag des BMAS ist bereits jetzt, so Schmachtenberg, ab Ende dieser Legislaturperiode in konzeptionelle Vorarbeiten einzusteigen: Denn die Frage der Umsetzung eines Obligatoriums ist voraussetzungsvoll.
Die Rentnergesellschaft zwischen Wirkung auf PSV-Mitgliederstruktur und -Risikoprofil …
Nach der Mittagspause wird am frühen Nachmittag eine weitere Podiumsdiskussion durch Marko Brambach, Vorstandsmitglied des PSVaG, mit der Erläuterung und einigen progressiven Thesen zum Thema „Quo Vadis Rentnergesellschaft“ eingeleitet.
„Die originäre Rentnergesellschaft wird vermehrt für ein neues lukratives Geschäftsmodell benutzt.“
Marko Brambach erläutert die Berührungspunkte von Rentnergesellschaften zum PSVaG: Wenn die finanziellen Mittel dieser sog. abgeleiteten Rentnergesellschaft nicht mehr dazu ausreichen, tritt ein Sicherungsfall ein und der PSVaG übernimmt die Rentenverpflichtungen. Das Umwandlungsgesetz ermöglicht auch, Rentenverpflichtungen ausgeschiedener Mitarbeiter von einem laufenden Geschäftsbetrieb abzutrennen und auf eine sog. originäre Rentnergesellschaft zu übertragen. Konkrete Vorgaben für die Kapitalausstattung von Rentnergesellschaften ergeben sich bisher nur aus dem Urteil des BAG vom 11. März 2008 (Az.: 3 AZR 358/06). Da die originäre Rentnergesellschaft vermehrt für ein neues lukratives Geschäftsmodell benutzt wird, weist Marko Brambach auf mögliche Auswirkungen auf die Mitgliederstruktur und auf das Risikoprofil des PSVaG hin.

Für einen interessanten Meinungsaustausch über das Ob und Wie erforderlicher rechtlicher Regelung und Regulierung von originären sowie abgeleiteten Rentnergesellschaften kommen dann die Rechtswissenschaftler Joachim Grote (geschäftsführender Partner BLD Bach Langheid Dallmayer Rechtsanwälte), Prof. Sebastian Roloff (Richter am Bundesarbeitsgericht, Honorarprofessor für Betriebsverfassungsrecht und Europäisches Arbeitsrecht Universität Leipzig), Prof. Martin Henssler (ehemaliger geschäftsführender Direktor des Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht Universität Köln, Of Counsel Seitz) und Aktuar Georg Thurnes (Vorstandsvorsitzender der aba) auf die Bühne.
… Mittel der Wahl …
Martin Henssler hebt im Rahmen der Diskussion grundlegend die Vorteile der professionellen Ausgestaltung von Rentnergesellschaften hervor. Er befürchtet für Arbeitnehmer bei einem professionellen Anbieter weniger Risiken als bei einem werbenden Unternehmen. Bei abgeleiteten Rentnergesellschaften sieht er grundsätzlich keine Missbrauchsgefahr im Falle eines Verkaufs an einen Dritten, bei einem Verbleib im Konzernverbund muss ein Missbrauch durch einen zu geringen Kaufpreis allerdings durch ein Regelungsinstrument unterbunden werden.
„Buy-out-Anbieter haben gerade ein Interesse an einer hohen Ausstattung.“
Die Anforderungen des BAG hält Henssler für originäre Rentnergesellschaften aus jetziger Sicht nicht mehr zeitgemäß: Das Bilanzrecht verhindert heute hinreichend den Mittelabfluss; eine weitere gesetzliche bzw. aufsichtsrechtliche Regelung ist nicht erforderlich. Bei Direktzusagen gibt es bei werbenden Unternehmen grundsätzlich keine Aufsicht.
Für ihn ist daher die Forderung nach einer Aufsicht bei den weniger risikoreichen Rentnergesellschaften inkonsequent. Er regt an, vor einer gesetzlichen Regelung zunächst ein Best-Practice-Modell zu entwickeln und an die Anbieter zu geben. Die Sorge vor einer zu geringen Ausstattung durch Übertragung auf professionelle Anbieter sieht Hennsler wegen der bilanzrechtlichen Vorgaben als nicht begründet an. Zudem steht dieser der Mechanismus des Geschäftsmodells entgegen: Weil Buy-out-Anbieter langfristig erfolgreich sein und die Rentner zufrieden stellen wollen, haben sie gerade ein Interesse an einer hohen Ausstattung der übernommenen Rentnergesellschaft.
… Doppeltreuhand …
Sebastian Roloff sieht das Erfordernis, zum Schutz der Betriebsrentnerrechte über die Ausstattung der Rentnergesellschaft bei Veränderungen der Gesetzgebung und der Rahmenbedingungen dauerhaft zu diskutieren.

Wichtig ist ihm aber der Kerngedanke des BAG-Urteils von 2008: Die bAV muss grundsätzlich einen realen Wert haben, dieser äußert sich durch die Anpassungsmöglichkeit und -pflicht. Das BAG hat ein Risiko bei (originären) Rentnergesellschaften in dieser Hinsicht erkannt und entschieden: Auch in einer originären Rentnergesellschaft muss daher die Anpassung zum Erhalt des Wertes der bAV möglich sein. Die Ausgliederung darf nicht dazu führen, dass wohlverdiente Betriebsrentnerrechte wie das Recht auf Anpassung der Rente verloren gehen.
Zur Frage, ob das BAG heute noch die gleichen Vorgaben aufstellen würde, meint Roloff, dass diese einen schadensrechtlichen Gesichtspunkt, weniger einen bilanzrechtlichen Gesichtspunkt hatten. Der Gedanke der Entscheidung, dem originären Arbeitgeber aufgrund der Nebenpflichtverletzungen in Anspruch zu nehmen, sei weiterhin richtig. Roloff ist nicht sicher, ob dies nur mit dem Bilanzrecht abgebildet werden kann.
„Gegebenenfalls könnte auch ein frühzeitiges Eingreifen bei einer Schieflage helfen.“
Roloffs Vorschlag für eine rechtssichere Gestaltung zur Auslagerung von Rentenverpflichtungen ist die Installation einer Doppeltreuhand als validen Schuldner der Versorgungsberechtigten. Gegebenenfalls könnte auch ein frühzeitiges Eingreifen bei einer Schieflage, wie es gedanklich dem StaRUG (Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen) zugrunde liegt, und die frühzeitige Einbeziehung des PSVaG einer Rentnergesellschaft helfen.
… angemessenen Rahmen …
Joachim Grote erläutert die grundsätzlichen Vorteile des Aufsichtsrechts für Versicherer trotz der vielen Anforderungen. Ein klares regulatorisches Umfeld bietet Sicherheit. Er sieht – unter Berücksichtigung von Proportionalität und Verhältnismäßigkeit – eine mögliche Lösung in der Orientierung an den Vorgaben des VAG für LVU bzw. EbAV. Für solche Vorgaben ist nicht die Rechtsprechung, sondern der Gesetzgeber gefordert. Es gibt einen bunten Strauß von Verwaltungsanforderungen, die man für Rentnergesellschaften sicher nicht braucht. Nicht verkehrt ist es dagegen, einen Liquiditätsabfluss zu vermeiden und eine zuverlässige Kapitalanlage zu fordern.
„Wenn die BAG-Rechtsprechung fällt, kommt es ohne anderen klaren Rahmen über kurz oder lang zu Insolvenzen.“
Grote bezieht sich auf die von Henssler zuvor als zu teuer kritisierten Liquidationsversicherungen. Diese können ihre Leistungen wegen des aufsichtsrechtlichen Rahmens nicht billiger anbieten. Die Anbieter der konkurrierenden Rentnergesellschaften wollen dagegen regulierungsfrei einen weiteren Markt – einen „grauen Versicherungsmarkt“ – öffnen.
Grotes Antwort auf die Frage, ob wir Regulatorik an dieser Stelle brauchen, lautet: Ja, man kann dies nicht dem Markt überlassen. Der Liquidationsversicherer ist so teuer, weil er so viel Geld erhebt, damit es nie zu einer Insolvenz des Liquidationsversicherers kommt. Diese Sicherheit gibt es bei den Rentnergesellschaften nicht.
Wenn die BAG-Rechtsprechung fällt, und es keinen anderen klaren Rahmen für Rentnergesellschaften gibt, kommt es über kurz oder lang zu Insolvenzen, blickt er voraus.
Zur Verringerung von Risiken bei originären Rentnergesellschaften schlägt Grote z.B. eine längere Nachhaftung für das abgebende Unternehmen sowie Vorgaben zur Kapitalanlage vor.
… und dem fehlenden Aufsichtsrecht
Georg Thurnes meint, die Kapitalausstattung einer Rentnergesellschaft muss zwar vorsichtiger sein als bei einem Unternehmen mit aktivem Geschäft, die Lösung für das „Wie viel“ hat auch er aber nicht dabei.
Das BAG-Urteil aus dem Jahr 2008 zur Ausstattung einer Rentnergesellschaft sieht der Aktuar kritisch. Auch schon damals ist die Entscheidung seines Erachtens nicht in allen Punkten richtig gewesen, z.B. hinsichtlich der vorgeschriebenen Sterbetafeln der Versicherungswirtschaft zur Bewertung von bAV-Verpflichtungen. Wichtiger als die Unterscheidung zwischen abgeleiteter oder originärer Rentnergesellschaft bewertet er den Umstand, ob der ursprüngliche Arbeitgeber liquidiert oder die Ausgliederung eine Konzernmaßnahme ist. Eine schöne Idee, findet Thurnes, wäre ein eigenes Aufsichtsrecht für EbAV, unter das auch Rentnergesellschaften fielen, das aber weit weg vom Niveau der Lebensversicherer ist. Ein eigenes Aufsichtsrecht für Rentnergesellschaften als Instrumente der Direktzusage hält er dagegen nicht für notwendig.
„Der Wirtschaftsprüfer passt auf!“
Thurnes sieht auch in der von Henssler angesprochenen Idee zur Entwicklung eines Best-Practice-Modells eine alternative Lösung. Dieses Modell kann sich an den vom BAG genannten Oberbegriffen orientieren. Wichtig sind ihm dabei noch die Berücksichtigung von Verwaltungskosten sowie Änderungen in der Rückstellungsabzinsungsverordnung und im Bilanzrecht. Wenn man diese Dinge hat, so Thurnes, gibt es schon jemanden der aufpasst: den Wirtschaftsprüfer! Dieser kann gut beurteilen, ob das Unternehmen „Rentnergesellschaft“ vernünftig unterwegs ist.

Thüsing, der während des Jubiläumssymposiums für einen regen Austausch auf der Bühne sorgt, wirkt dann am Nachmittag auf ein pünktliches Ende für den abschließenden gemeinsamen Umtrunk hin.

Die Autorin ist Syndikusrechtsanwältin in der Rechtsabteilung des PSVaG in Köln.
Von Autorinnen und Autoren des Pensions-Sicherungs-Vereins VVaG sind zwischenzeitlich bereits auf PENSIONS●INDUSTRIES erschienen:
Am 7. Oktober in Köln (II): Lage und Perspektive des PSV: DAV/DGVFM-Jahrestagung 2023 in Dresden (IV) – Der PSV und die Pensionskassen:
50 Jahre PSVaG!
von Marina Stürmer, 24. Oktober 2024
Zwischen Zahlen und Gefühlen
von Dr. Martin Lätsch und Dr. Benedikt Köster, 9. April 2024
Rückblick – Praxis – Ausblick
von Dr. Martin Lätsch, 1. Juni 2023