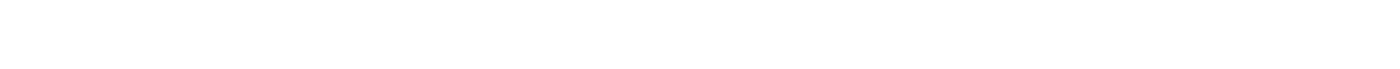Mühlsteine, Numerus Clausus, Windfall-Profits, Versteinerungen, Sammelsurium, soziale Verwerfungen, Kannibalisierung … zu einseitig konzentriert, zu zementiert, zu wenig, zu niedrig, zu kompliziert, zu starr, nicht verlässlich planbar, chancenlos, unsinnig: Zahlreiche der deutschen bAV-Topjuristen trafen sich jüngst in der Hauptstadt und zogen eine Bilanz zur Lage des deutschen Pensionswesens, die an Klarheit nichts zu wünschen übrig ließ – und sind konstruktiv genug, auch Abhilfe zu formulieren. P●I-Autor Detlef Pohl war dabei.
Jüngst hatten die Arbeitsrechtlerinnen und Arbeitsrechtler des Eberbacher Kreises ihre Forderungen in Sachen bAV unter dem Titel „Jetzt den Durchbruch für die flächendeckende Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung ermöglichen“ an die Politik gerichtet. Ungeschminkt heißt es dort, dass Deutschland auf „eine ernsthafte Altersvorsorgemisere zusteuert“. Am 2. April haben die bAV-Fachanwälte in der Hessischen Landesvertretung in Berlin-Mitte auf einem Kongress ihre Forderungen ausdiskutiert – und das mit klaren Worten. Die Politik glänzte durch die Bank mit Abwesenheit. Doch der Autor war in Berlin dabei und dokumentiert die wichtigsten Aussagen – wegen der Inhaltsdichte im schnellen P●I-Stakkato und sämtlich im Indikativ der Referenten.
Arteaga: Rahmenbedingungen gehen an den Bedürfnissen vorbei

„Das Rentenniveau wird sinken“, sagt Marco Arteaga, Partner bei Luther Rechtsanwaltsgesellschaft sowie Sprecher des Eberbacher Kreises, in seiner Auftaktrede. Eine Stärkung der bAV erfordere ein stärkeres Engagement der Arbeitgeber, besonders in KMU, wo die bAV bisher nahezu nicht vorkommt, „jedoch gehen die gesetzlichen Rahmenbedingungen der bAV an den Bedürfnissen ausgerechnet dieses besonders beschäftigungsintensiven Teils der deutschen Wirtschaft vorbei“. Weiter sagt Arteaga:
+++ Ausgangslage: Betriebsrenten in Deutschland viel zu kompliziert und starr +++ Firmen durch Versorgungsversprechen über Jahrzehnte gebunden und nahezu ohne Chance, Systeme an veränderte Bedingungen anzupassen oder Verpflichtungen auf Dritte zu übertragen – selbst wenn Versorgungsberechtigte keine Nachteile haben +++ Kosten der Altersversorgung weder nach Höhe noch nach Zeitpunkt ihrer Entstehung verlässlich planbar +++ vor allem verlangt deutsches Betriebsrentenrecht vom AG uneingeschränkte Einstandspflicht: auch bei sorgfältiger und angemessener Finanzierung haftet er uneingeschränkt +++ daher bieten vor allem KMU fast durchweg keine bAV +++ folgerichtig stagniert bAV-Verbreitung seit Einführung BetrAVG vor 50 Jahren gerade in diesem beschäftigungsintensiven Segment auf sehr niedrigem Niveau +++ rund 50% aller Beschäftigten ohne Aussicht auf bAV +++ bAV-Höhe mit durchschnittlich rund 100 Euro pro Monat viel zu niedrig +++
„Die unternehmerische Handlungsfähigkeit muss auch mit bAV erhalten bleiben.“
+++ jetzt dringend erfolgreiche Rezepte aus dem Ausland ansehen +++ bAV leistet in NL, CH, UK oder CAN Vielfaches der deutschen Betriebsrenten +++ dortige Systeme gewährleisten für AG Kosten- und Rechtssicherheit und bieten Chance zur flexiblen Anpassung im Zeitablauf, ohne Versorgungsberechtigte zu benachteiligen +++ Deutschland: Gesetzgeber, Verwaltung und Gerichte viel zu lange einseitig auf Sicherung bestehender Betriebsrentensysteme konzentriert +++ zwingend erforderlich und überfällig, gesetzliche bAV-Bedingungen so zu gestalten, dass für AG Kostensicherheit, Rechtssicherheit, Flexibilität und bessere Übertragbarkeit von Versorgungsversprechen erreicht wird +++ unternehmerische Handlungsfähigkeit muss auch mit bAV erhalten bleiben +++
+++ Eberbacher Kreis als Versammlung spezialisierter bAV-Rechtsanwälte verlangt deshalb gesetzliche Korrekturen in vielen Bereichen, unterlegt mit acht Forderungen +++ vier davon betreffen allein die reine Beitragszusage (RBZ):
Forderung 1: Entfall des Tarifvorbehalts für RBZ: „Die RBZ, die nach geltender Rechtslage ausschließlich via Sozialpartnermodelle (SPM) auf tarifvertraglicher Grundlage vereinbart werden können, müssen für alle Unternehmen möglich sein, auch wenn sie nicht tarifgebunden sind oder wenn ein für ihre Branche und ihre Region geltender Flächentarifvertrag nicht existiert“, fordert Arteaga (der als Mitautor des maßgeblichen BMAS-Gutachtens 2016 als einer der Väter des SPM gilt):
+++ Tarifvorbehalt müsse deshalb entfallen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2a BetrAVG) +++ existiert kein einschlägiger Flächen-TV und kommt mit der zuständigen Gewerkschaft auch ein Haus-TV nicht zustande, muss RBZ auch auf rechtlicher Grundlage einer Einzel- oder Gesamtzusage oder Betriebsvereinbarung möglich sein +++
Forderung 2: Alternativ: Die Ermöglichung RBZ auch als „Verbandsmodell“ von Berufs- oder Branchenverbänden, wenn ein Tarifvertrag nicht existiert: „Sofern die zu bevorzugende, umfassende Freigabe der RBZ politisch nicht durchsetzbar ist, sollte im Gesetz neben dem SPM zumindest ein ergänzendes ‚Verbandsmodell“ zugelassen werden, im Rahmen dessen Berufs- oder Branchenverbände allein oder im Zusammenschluss mit anderen Verbänden ein entsprechendes Finanzierungsvehikel konzipieren können“, fordert Arteaga im Namen der Eberbacher:
+++ statt „Beteiligung an Durchführung und Steuerung“ der TV-Parteien (§ 21 Abs. 1 BetrAVG) würde Überwachung gesetzlich vorgegebener Qualitätsanforderungen durch BaFin treten +++ Genehmigung für Aufnahme des Geschäftsbetriebs von SPM daran zu knüpfen, dass auf Basis seriösen Geschäftsplans innerhalb eines überschaubaren Zeitraums vernünftige Größe erreicht wird +++ „Nach den Erfahrungen im Ausland wird man hier ein Deckungskapital von wenigstens 1 Mrd. Euro verlangen müssen, welches spätestens nach 10 Jahren erreicht werden wird“, hat Arteaga beobachtet +++
Forderung 3: Einfache Kontenmodelle für flexible Dotierungen, beliebige Übertragbarkeit und Transparenz: „Verwaltungstechnisch müssen RBZ durch den Versorgungsträger kontenhaft aufgebaut sein, damit Beiträge beliebiger Provenienzen aufgenommen und auseinandergehalten werden können“, fordert Arteaga:
+++ aufs Konto gingen dann sowohl kontinuierliche als auch unregelmäßige Arbeitgeberbeiträge, aber auch Entgeltumwandlungsbeiträge, Sonderzahlungen, Abfindungen, Förderbeiträge, private Aufstockungen usw. +++ Saldo könnte prinzipiell zu jeder Zeit, insb. bei AG-Wechsel, auf andere Kasse dieser Art übertragen werden +++ neues Versorgungsvehikel für RBZ sollte in DiGiRü integriert werden +++
Veit: Man erinnere sich an den 40b
Forderung 4: Steuerfreiheit für Dotierungen von RBZ: „Sämtliche Dotierungen für RBZ müssten grundsätzlich genau wie Direktzusagen (§ 6a EStG) bzw. U-Kassen (§ 4d EStG) unbeschränkt steuerfrei möglich sein und dann nachgelagert besteuert werden“ fordert Arteaga:
+++ Renten aus RBZ gibt es bisher nicht +++ allenfalls steuerliche Deckelung bei Beitragshöhen von z.B. 20% oder besser 30% der BBG denkbar +++ ausreichend hohe Dotierung notwendig, damit nennenswerte Versorgung weitgehend innerhalb eines einzigen Durchführungswegs organisierbar +++ nur so bAV für KMU einfach zu handhaben: einheitliches Versorgungsmodell mit einem einzigen Träger und einheitlichen Regeln auf der Beitrags- und auf der Leistungsseite +++ „Der bisher gängige, aufwendige und häufig inkonsistente Durchführungswegemix wird vermieden“, hofft Arteaga.

„Für eine nennenswerte bAV in Höhe von 10% bis 20% des Einkommens müssten rund 15% der Bezüge als Beitrag aufgewendet werden“, sagt Annekatrin Veit, Rechtsanwältin, Partner bei Luther, die auf mehrere Absurditäten der bAV im Steuerrecht eingeht:
+++ steuerfreies Volumen von 8% BBG (§ 3 Nr. 63 EStG) reicht bei versicherungsförmigen Durchführungswegen oft nicht für nennenswerte bAV +++ Mehraufwand würde mehr Lohnsteuer kosten und Nettoeinkommen verringern +++ Ausweg: gespaltene Versorgungszusage durch DFW-Mix (mehrere Nachteile) oder Neuregelung für Pauschalsteuer auf den vom AG entrichteten Beitrag (bezahlt auch AG) +++ dann – analog zu früherem § 40b – wahlweise „Rückkehr“ zur vorgelagerten Besteuerung +++ anwendbar z.B. bei Pensionsfonds-Dotierung: bislang bei Ablösung nur Teil der Prämie sofort als Betriebsausgabe abziehbar, der Rest über 10 Jahre zu verteilen +++ neue Idee: Erhebung einer Pauschalsteuer auf AG-Beitragsleistung +++
Diller: „Zusagen-Zoo“ in Unternehmen vereinfachen
Forderung 5: Zulassung einer barwerterhaltenden Harmonisierung betrieblicher Versorgungsversprechen: „Arbeitgebern müsste kraft Gesetzes Vereinheitlichung bisheriger bAV möglich gemacht werden“, fordern die Eberbacher.
„Die Flickenteppiche“ verursachen enorme Kosten.“
+++ Sammelsurium unzähliger Versorgungsordnungen in einem einzigen Unternehmen muss Ende haben +++ „Flickenteppiche“ verursachen enorme Kosten – letztlich zu Lasten der Begünstigten +++ Prinzip für Vereinheitlichung muss Barwerterhaltung bzw. -identität des Versorgungsanspruchs vor und nach Vereinheitlichung sein +++ aber: barwertidentische Ablösung muss auch ausreichen, selbst wenn sich dabei Details ursprünglicher Versorgungszusage verändern +++ stärkere ökonomische Betrachtungsweise muss uneingeschränkt auch für Past Service gelten +++ bei Future Service muss es AG möglich sein, sich von dem Versorgungsversprechen zu lösen, denn bAV ist fast vollständig als Entgelt für geleistete Arbeit anzusehen (Betriebstreue deutlich in Hintergrund getreten) +++ Folge: Entgeltversprechen – genau wie Barentgelt – muss angepasst werden dürfen (und gerichtliche Überprüfung muss auf eine reine Willkürkontrolle beschränkt werden) +++

Prof. Martin Diller, Partner bei Gleiss Lutz Rechtsanwälte, plädiert „für ein Ende des Zusagen-Zoos in den Unternehmen“:
+++ gemeint: Vielfalt unterschiedlicher Versorgungsregelungen gerade in großen Konzernen, die sich nicht anpassen lassen – „Mühlstein um den Hals der HR-Abteilungen“ +++ Beispiel Evonik: 111 Regelungen in 17 Konzern-Gesellschaften, auch wegen Schließung und Ablösung alter Versorgungswerke, Systemwechsel, individueller Verbesserungen, Einzelzusagen, Übernahmen oder Umstrukturierung +++ Langlebigkeit verschärft Problematik +++
„Beispiel Evonik: 111 Regelungen in 17 Konzern-Gesellschaften.“
+++ Folgen: unverhältnismäßiger Admin-Aufwand (negative Skaleneffekte), sinkende Attraktivität für Transaktionen, steigende Rechtsrisiken, fehlende Skaleneffekte bei kleinen Beständen +++
+++ Ausweg 1: ersatzlose Schließung von Versorgungswerken für Neueintritte, aber keine Lösung für Bestand und zudem Verbreitungshindernis für bAV +++
+++ Ausweg 2: Harmonisierung bestehender Versorgungswerke, aber Anpassung „nach oben“ wirtschaftlich ausgeschlossen, ggf. Verschlechterung für einzelne Arbeitnehmer und Vereinheitlichung des Durchführungswegs nötig (Wechsel nur durch wertgleiche Übertragung erlaubt) +++ viele rechtliche Hürden für Harmonisierung +++ mögliche gesetzliche Erleichterungen: einseitiges Recht zur wertneutralen Harmonisierung, Anerkennung des Harmonisierungsinteresses (insb. nach Betriebsübergang) und summenmäßig erweiterte Abfindungsoptionen +++
Döring: Problem der Übertragung von Versorgungsverpflichtungen
Forderung 6: Erleichterungen für die Übertragbarkeit von Versorgungsverpflichtungen: „Das bislang in § 3 BetrAVG normierte, fast vollständige Verbot zur Abfindung von Anwartschaften ausgeschiedener AN wie auch der enge Numerus Clausus der Möglichkeit zur Übertragung betrieblicher Versorgungsverpflichtungen auf Dritte (§ 4 BetrAVG) sind deutlich zu starr“, kritisieren die Eberbacher.
+++ Regelungen zwingen Unternehmen häufig, Versorgungsverpflichtungen jahrzehntelang selbst weiterzuführen, auch wenn wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll +++ häufig stehen fortzuführende Versorgungsverpflichtungen auch Liquidation der Firma im Wege +++ nötig: mehr Flexibilität und Rechtssicherheit, um Übertragungen sicher und schuldbefreiend zu ermöglichen +++

„In § 4 BetrAVG ist viel drin, aber manche Klarstellung wäre nötig“, sagt René Döring, Partner bei Linklaters, mit Blick auf die Übertragung von Versorgungsverpflichtungen:
+++ bei Inaktiven gilt ausserhalb des Umwandlungsrechts Übertragungsverbot, bei Liquidation allenfalls Übertragung auf Liquidationsversicherung +++ zahlreiche Problemfälle in der Praxis +++
„Die Umstellung ist oft wirtschaftlich unsinnig.“
+++ Liquidationsversicherung für viele Versicherer als Produkt uninteresting und nur zu sehr hohen Kosten erhältlich +++ Bei mittelbaren Durchführungswegen Umstellung oft wirtschaftlich unsinnig – Beispiel Unternehmensliquidation und Pensionskassenzusagen: anders als bei Insolvenz ist unveränderte bAV-Fortführung über PK als Liquidationsversicherung nur möglich, wenn PK-Rechnungszins kleiner oder gleich dem bei Liquidation jeweils geltenden Höchstrechnungszins ist (§ 4 Abs. 4 S. 2 BetrAVG) +++ ohne diese Voraussetzung muss auf neuen Tarif mit Zins umgestellt werden, der Anforderungen des § 4 entspricht +++ gilt auch bei wirtschaftlich guter Lage der PK +++ Folge der Umstellung: erhebliche Mehrkosten für AG und Windfall-Profit für Berechtigte (höhere Anpassungen) +++ zudem je nach PK adäquater Tarif nicht verfügbar +++
Granetzny: Wider die Rechtsunsicherheit und die untragbaren Kostenrisiken
Forderung 7: Beschleunigte Herstellung von Rechtssicherheit nach Änderung von Versorgungsregelungen: „Es muss eine angemessene, faire Lösung geschaffen werden, die AG bei Änderungen betrieblicher Versorgungsregelungen, insb. bei ablösenden Betriebsvereinbarungen, in engem zeitlichen Zusammenhang Rechtssicherheit verschafft, ob die Änderung wirksam ist“, fordern die Eberbacher:
+++ könnte durch gerichtliche Überprüfung geschehen +++ Unsicherheiten über rechtliche Wirksamkeit früherer Umstellungen kommen oft erst bei Unternehmensnachfolge oder -veräußerung hoch und lösen meist erhebliche finanzielle Einbußen aus +++ nach aktueller Rechtslage muss AN nicht bereits im laufenden Arbeitsverhältnis unwirksame Änderung angreifen, sondern erst bei Renteneintritt +++ Rente beginnt nicht selten erst Jahrzehnte nach Änderung der Versorgungsregelung +++

„Die Praxis benötigt mehr Rechtssicherheit bei Änderung und Anpassung von Versorgungszusagen“, sagt Thomas Granetzny, Partner bei Freshfields Bruckhaus Deringer:
+++ aktuelle Rechtsunsicherheiten führen zu untragbaren Kostenrisiken +++ Angst vor Unwirksamkeit führt zur „Versteinerung“ historischer Zusagen und steht sachgerechter Neugestaltung im Weg +++ Zwei-Klassen-Gesellschaft („unantastbare teure Altzusagen“ vs. „schmal dotierte oder keine Neuzusagen“) wird so zementiert, was ungerecht ist +++
„Wer fürchten muss, Zusagen nie mehr anpassen zu können, gibt erst gar keine ab.“
+++ Beispiel: AG hat 1982 mit Betriebsrat Betriebsvereinbarung über endgehaltsbezogene Versorgungszusage abgeschlossen, aber 2005 für Neueintritte geschlossen (neue AN erhalten nur noch Entgeltumwandlung in Direktversicherung) +++ Vorschlag des BR: alle AN bekommen künftig Beiträge ins SPM bezahlt; Umsetzung durch Änderung der Betriebsvereinbarung +++ wirksam möglich, da Betriebsvereinbarungen kündbar sind (§ 77 Abs. 5 BetrVG) +++ Neuregelung für Bestandsmitarbeiter nur unter Wahrung von Vertrauensschutz (Prüfungsmaßstab zu hart) +++ spannende Fragen bei Umstellung auf SPM: Wird BAG den Wegfall der Garantie per se als unangemessen ansehen? Wird es ausreichen, wenn prognostizierte Zielrente nicht geringer als derzeit zugesagte Leistung? Wird gleiche Beitragshöhe ausreichen? +++
+++ bleibt Status-quo, also ohne Umstellung, werden soziale Verwerfungen zementiert +++ späte Kontrollbefugnis der Arbeitsgerichte hindert bAV-Verbreitung +++ „Arbeitgeber, die befürchten müssen, Zusagen niemals mehr rechtssicher anpassen zu können, geben erst gar keine ab“ +++ Auswege: freiwillige Aufgabe der 3. Stufe durch BAG oder freiwillige Rückführung der 3. Stufe auf echte Willkürkontrolle durch BAG oder gesetzgeberische Regelung ohne 3. Stufe bzw. gesetzgeberische Anerkennung der sachnäheren betrieblichen Regelungsmacht +++ Fazit: grundsätzliche Akzeptanz sachnäherer betrieblicher Gestaltungsmacht der Betriebspartner durch die Arbeitsgerichte erforderlich +++
Buddenbrock: Widersprüche zwischen Betriebsrenten- und Aufsichtsrecht
Forderung 8. Beseitigung der Kollisionen von Versicherungsaufsichtsrecht und Arbeitsrecht:„Die bAV bedient sich vielfach Trägern, die nach Vorschriften des VAG der Staatsaufsicht durch die BaFin unterliegen, wobei es wegen widersprüchlicher rechtlicher Regelungen bzw. Wertungen im Versicherungsaufsichtsrecht und im Betriebsrentenrecht zu erheblichen Kollisionen kommt“, kritisieren die Eberbacher.
+++ dringend Kohärenz der rechtlichen Bedingungen herstellen, um Praxis rechtssicher zu machen +++ dazu gehört Vorrang kollektivrechtlicher arbeitsrechtlicher Regelungen bei Änderung versicherungsgestützter Versorgungsmodelle +++ umgekehrt schlagen aufsichtsrechtlich genehmigte oder sogar angeordnete Leistungsmodifikationen des Versicherers auf arbeitsrechtliche Verpflichtung des AG durch +++ Harmonisierung dringend nötig +++

„Widersprüche von Betriebsrenten- und Versicherungsaufsichtsrecht zeigen sich drastisch bei der Bewertung der aktuellen Rechtslage und des Reformbedarfs bei Pensionskassen“, sagt Christian v. Buddenbrock, Partner bei DLA Piper:
+++ gerade „konzernbezogene“ PK leiden zunehmend unter regulatorischen Anforderungen +++ Unternehmen suchen verstärkt Möglichkeiten, sich von wachsendem administrativem Aufwand und Risiken aus Geschäftsbetrieb zu lösen +++ Arbeitsrecht: AN hat Anspruch auf Leistung gegen PK, aber AG bleibt bei Ausfall der PK leistungsverpflichtet (§ 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG) +++ Versicherungsaufsichtsrecht: bei regulierten PK regelt Satzung, ob Nachschüsse möglich oder nicht und ob Ansprüche gekürzt werden dürfen (§ 179 VAG), auch BaFin kann Leistungskürzungen anzuordnen (§ 314 Abs. 2 VAG) +++ Optionen: Bestandsübertragung oder Liquidation mit Folgelösung zur Durchführung der bAV+++ Bestandsübertragungen scheitern oft an von der Aufsicht aufgestellten Hürden +++ rechtskonforme Folgelösungen werden von der Aufsicht ebenfalls nicht mitgegangen (das macht die Situation schwer, da Folgelösungen zur Problemlösung zwingend sind) +++
„Gerade konzernbezogene Pensionskassen leiden zunehmend unter regulatorischen Anforderungen.“
+++ um Optionen rechtssicher auszuführen, bedarf es mindestens dreier Korrekturen durch Gesetzgeber: 1. Rückkehr zur im BRSG-II-E geplanten Neuregelung von § 3 Abs. 2 BetrAVG (Fiktion der Abfindung bei Liquidation der Kasse) +++ 2. für Bestandsübertragungen Novellierung des § 13 VAG nötig: muss ausreichen, wenn das Versorgungsniveau und die zugesagte Versorgungsqualität erhalten bleiben. Für nicht übertragbare Teile des Versorgungsversprechens muss Leistungsverpflichtung des AG (nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG) ausreichen +++ 3. es muss Möglichkeit geschaffen werden, Versorgung auf andere Träger zu übertragen +++
Soweit zu den acht Forderungen des Eberbacher Kreises. Die Arbeitsrechtler merken jedoch zu zwei weiteren Punkten – zum Beitragsobligatorium und zur Zulagenförderung – inhaltlich an:
Reichel: Finger weg vom Obligatorium …
Der Eberbacher Kreis spricht sich klar gegen Einführung eines allgemeinen Beitragsobligatoriums aus:
+++ Obligatorium von vielen Experten gefordert, weil Leistungsreduktion im Pflichtsystem (erste Säule) nicht in Breite durch rein freiwilliges System (zweite Säule) kompensiert werden kann +++ aber bAV ist freiwilliges System und kann grundsätzlich angestrebte Flächendeckung auch ohne Obligatorium erreichen +++ nun geboten, Bedingungen für bAV auch für AG so zu ändern, dass sie gern Versorgungszusagen erteilen, ohne sich durch starres Konstrukt auf Jahrzehnte zu knebeln +++ geforderte Änderungen für mehr Kosten- und Rechtssicherheit, zur Flexibilisierung und zur Übertragbarkeit schaffen diese Voraussetzungen.

„Ein Obligatorium bedeutet Pflichtbeiträge des Arbeitgebers und/oder Arbeitnehmers zu einer bAV-Zusage“, betont Christian Reichel, Partner bei Baker & McKenzie:
+++ konsequent: Schweizer Modell, mit Opt-out-Möglichkeit auch in Großbritannien +++ in Deutschland bisher nicht +++ deutsche bAV bislang aber auch durch SPM nicht deutlich stärker verbreitet, weil sich TV-Parteien zurückhalten und SPM derzeit in Industrien mit ohnehin starker bAV-Durchdringung eingeführt +++ Obligatorium würde Engagement der AG bremsen und bAV als Benefit entwerten +++ Obligatorium brächte auch Kostensteigerung für alle AG und AN, Begrenzung unternehmerischer und betrieblicher Freiheit, Steigerung der Bürokratie durch Aufklärung und Verwaltung sowie Kannibalisierungseffekte auf bestehende Zusagen +++ besser: Ausbau freiwilliger bAV durch Abbau von Komplexität, Risiken und Bürokratie für AG sowie steuerliche Incentivierung +++
… Kritik am Prozedere der Zulagen- und Geringverdienerförderung
„Die Altersvorsorgezulage (nach Abschnitt XI EStG) sieht ergänzende staatliche Zahlungen zu privaten Vorsorgeleistungen vor und kann auch im Rahmen der Entgeltumwandlung eingebracht werden (§ 1a Abs. 3 BetrAVG), allerdings scheuen Arbeitgeber das verwaltungsaufwendige Prozedere“, kritisieren die Eberbacher.
+++ wenn Zulagenförderung deutlich vereinfacht würde, sollte dies mit SPM oder „Verbandsmodell“ kombiniert und so verwaltungstechnisch stark vereinfacht werden +++ Zulagen könnten jederzeit von Zulagenstelle für Altersvermögen direkt ins individuelle Konto des Sozialpartner- bzw. Verbandsmodells eingezahlt werden, wo jede Einzahlung ihrer Herkunft entsprechend markiert wird +++ wenn entsprechendes Beitragskonto noch nicht existiert, könnte Versorgungsträger, der RBZ durchführt, auch Einzelpersonen als Versicherte aufnehmen +++
+++ Geringverdienerförderung (nach § 100 EStG) sollte ausgebaut werden +++ bewirkt vor allem bei besonders niedrigen Einkommen, dass überhaupt bAV mit einigermaßen vernünftigem Sparvolumen zustande kommt +++ wie bei Zulagenförderung kann förderfähiger AG-Beitrag direkt ins Beitragskonto des SPM oder Verbandsmodells eingebracht werden +++
Fazit von PENSIONS●INDUSTRIES
Wahrlich keine Fachtagung wie jede andere. Die Finger an vielen Punkten in die Wunde gelegt, um bAV vor allem in Klein- und Mittelbetrieben endlich voranzubringen. Dabei wird nicht mehr Geld vom Staat verlangt, sondern mehr Vernunft beim Geldeinsatz, gekoppelt mit dem Wunsch, Absurditäten zu beseitigen, Bürokratie abzubauen und den AG als Ausgangspunkt einer gesellschaftlich gewünschten Sozialleistung bAV nicht noch weiter zu verprellen.
Mag manch einem manche Idee auf den ersten Blick auch überholt erscheinen – etwa die vorgelagerte Besteuerung freiwillig aufgebauter bAV –, so dürften die allermeisten Reform-Ideen nicht nur überfällig sein, sondern die Kraft haben, auf 80% Prozent Verbreitungsgrad hinzusteuern und auch die Durchschnittshöhe der deutschen Betriebsrenten deutlich anzuheben.
Richtig ist aber auch: Reformen, wie sie die Eberbacher anstreben, kämen in der in zahlreichen Rechtsgebieten tief verästelten deutschen bAV – wo das Drehen einer Stellschraube Dutzende andere (oftmals verdeckt) mitdreht – einer Kernsanierung, gar Neuaufstellung gleich.
Allerdings zeigt die unterdurchschnittliche Teilnahme der Sozialpolitiker am Kongress, dass die inhaltlichen Prioritäten offenbar weiter ganz woanders liegen und die zweite Säule noch immer unter dem Radar fliegt. Um die offensichtliche Misere abzuwenden, dazu hat der Eberbacher Kreis praktikable Vorschläge gemacht. Den Abwesenden sei nun zumindest zugerufen: Wer lesen kann, ist echt im Vorteil.