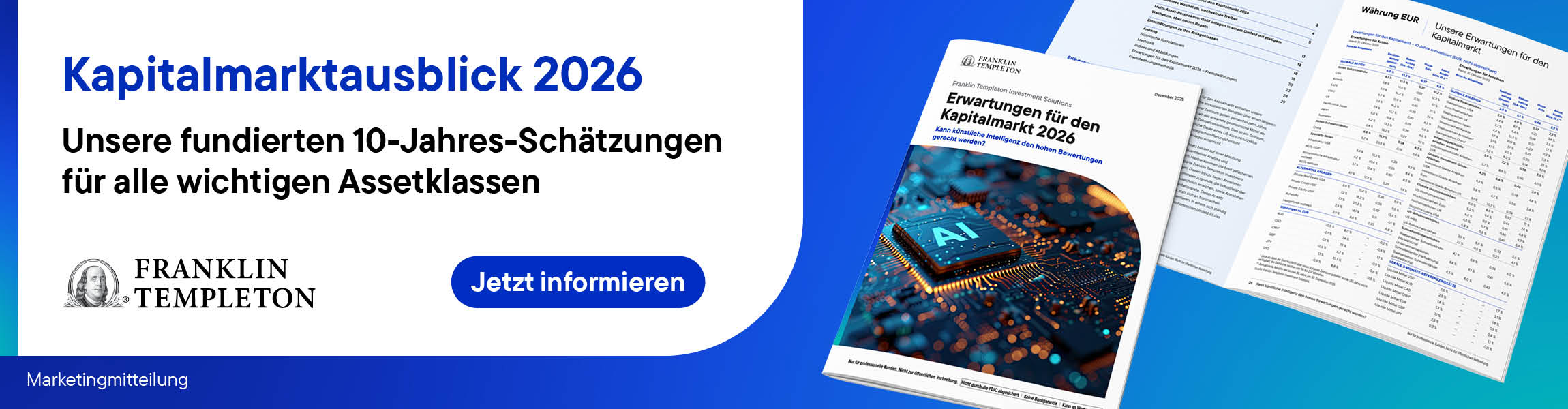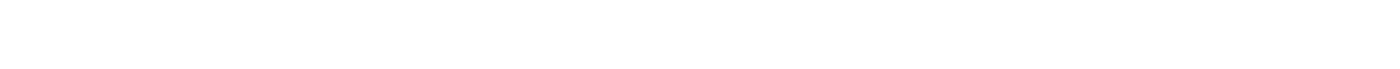Deutschland bewegt sich auf eine ernsthafte Altersvorsorgemisere zu, fürchten(nicht als einzige) die im Eberbacher Kreis organisierten Arbeitsrechtler. Sie mahnen erneut dringliche Korrekturen an, um der bAV endlich flächendeckend zum Durchbruch zu verhelfen. P●I-Autor Detlef Pohl fasst die wichtigsten Punkte des jüngsten bAV-Gipfels in Berlin zusammen. Und: In einem Punkt gibt es wenigstens mal keine Defizite.
Schon im Frühjahr hatte der Eberbacher Kreis in einem 8-Punkte-Plan Forderungen für eine nachhaltige bAV-Reform, die den Namen auch verdient, in die Öffentlichkeit getragen. Nun haben sie erneut nachgelegt:
Vorgestern, Berlin-Mitte, Hessische Landesvertretung: Unter dem Titel „Reset in der Alterssicherung in Deutschland“ haben die namhaften Arbeitsrechtler Politik und Parkett bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr eingeladen und sich in der Agenda ganz auf die Sorgen und Nöte derjenigen fokussiert, auf die es in Sachen Verbreitung der bAV zentral ankommt: die Arbeitgeber.
In einem nicht-öffentlichen sog. „Power-Frühstück“ im Kreis von Abgeordneten präsentiert der Kreis bAV-Erfolgsmodelle aus dem Ausland. „Hier liegen die entscheidenden Lösungsansätze, von denen Deutschland lernen kann – und muss“, betont Marco Arteaga, Rechtsanwalt und Partner bei Luther RAe sowie Sprecher des Eberbacher Kreises. Nach dem parlamentarischen Frühstück bietet der Kreis der Fachöffentlichkeit einen ausführlichen Einblick in die geforderten Reformansätze, die zu einer Trendumkehr im System der Alterssicherung in Deutschland anregen:
Bitte keine der üblichen Kommissionen
Im Grunde werden dieselben Forderungen wie bei dem Kongress im Frühjahr erhoben. Diesmal richten die Eberbacher aber einen deutlichen Appell an die Bundesregierung. Man will die Abgeordneten und Fachpolitiker auf eine schnelle Reform einschwören, um den Anstieg immer weiterer Leistungen aus dem Bundeshaushalt in die GRV zu bremsen, die sich 2025 bereits auf rund 120 Mrd. Euro summieren. Dies soll an einem „Runden Tisch“ geschehen, unter Verzicht auf eine Rentenkommission bisheriger Prägung, wie sie von der Bundesregierung vorgesehen ist.

„Die Zuschüsse und Erstattungen an die Rentenversicherung beanspruchen bereits rund ein Viertel des Bundeshaushalts, mit stark steigender Tendenz. Diese instabile Situation beschädigt das Vertrauen der Bevölkerung in die Rente und gefährdet im Ergebnis unsere Demokratie als Ganzes“, erklärt Arteaga.
Mehr zweite statt mehr Steuern in die erste …
Im Kern der Vorschläge (s. ausführlich hier) steht also, den Anstieg der Leistungen, die aus dem Bundeshaushalt für die GRV gezahlt werden, deutlich zu dämpfen.

Als Ausgleich für die daraus insgesamt resultierenden geringer steigenden Renten fordern die Eberbacher eine flächendeckende Verbreitung der Betriebsrenten in Deutschland. Die bAV soll quasi die Rente retten, oder besser: Die bAV soll den Bundeshaushalt vor der GRV retten.
… und das in vier Schritten – mit Bewährung
Wie erwähnt, hatten die Eberbacher schon im Frühjahr einen Plan erarbeitet, der eine grundlegende Vereinfachung des deutschen Betriebsrentenrechts empfiehlt – und der nun einem breiteren Politiker-Kreis nähergebracht wird. Die im Kreis organisierten Wirtschaftsanwälte mit Schwerpunkt bAV und Arbeitsrecht appellieren an Regierung und Parlament, unverzüglich in vier Schritten einen Reset der Alterssicherung in Deutschland in die Wege zu leiten:
I. Reform der gesetzlichen Rentenversicherung:
Die Finanzierung muss reformiert werden. Die Stellschrauben, die jeweils die Einnahmen- bzw. Ausgabenseite der GRV beeinflussen, sind hinlänglich bekannt. Es ist erforderlich, an einem „Runden Tisch“ mit allen Beteiligten Beschlüsse zu fassen, bei der alle Stellgrößen einbezogen werden, um die Mittel aus dem Bundeshaushalt kontinuierlich zurückzufahren.
Namentlich müssen auch Forderungen nach Ausweitung des Versichertenkreises vom Tisch, insb. wenn klar erkennbar ist, dass die einzubeziehenden Personenkreise aufgrund ihrer versicherungstechnischen Risikostruktur den Finanzmittelbedarf der Rentenversicherung strukturell weiter erhöhen würden.
II. Keine neue Rentenkommission:
Die Rentenkommissionen früherer Legislaturperioden haben bereits alle Erkenntnisse zusammengetragen, die für politische Entscheidungen benötigt werden. Es gibt auf Expertenebene keinerlei Erkenntnisdefizite. Eine neue Rentenkommission wird keine zusätzlichen Erkenntnisse liefern können.
Entscheidend ist nun, dass die politischen Parteien jetzt die Erwartungen der Bevölkerung erfüllen und Entscheidungen treffen.
III. Massiver Ausbau der bAV:
Weniger Finanzmittel aus dem Bundeshaushalt für die GRV sind für die dauerhafte Reform der Alterssicherung jedoch nicht ausreichend. Es ist eine zusätzliche Rente erforderlich, die die gesetzliche Rente ergänzt – sinnvollerweise nur im Bereich der bAV. „Die bAV ist kollektiv organisiert, fasst also große Gruppen von Beschäftigten in einem ganzen Unternehmen oder einer ganzen Branche als Versichertengemeinschaft zusammen. Sie kann daher die biometrischen Risiken Langlebigkeit, Invalidität und Tod gut abdecken und beherrschen“, erklärt Arteaga.
Die bAV basiert grundsätzlich auf einem Sparvorgang, der das benötigte Versorgungskapital im Voraus planmäßig bildet. Darin unterscheidet sie sich von der GRV, die die finanziellen Mittel für die Rentenzahlungen erst zum Zeitpunkt von deren Fälligkeit im Umlageverfahren, also durch Versicherungsbeiträge und staatliche Zuschüsse im jeweiligen Jahr aufbringt.
IV. „Bewährungsfrist“ für freiwillige bAV:
Nach der grundsätzlichen Reform muss der Wirtschaft eine angemessene „Bewährungsfrist“ für die Umsetzung eingeräumt werden. Erst wenn nach Ablauf dieser Frist keine deutlich bessere bAV-Verbreitung zu verzeichnen ist, sollte über entsprechende gesetzlich verankerte Beitragspflichten zur bAV entschieden werden.
Und die bAV selbst?
Ausführlich gehen die Eberbacher erneut auf den Reformbedarf bei der bAV selbst ein. „Im internationalen Vergleich hinkt die bAV in Deutschland den tatsächlich bestehenden Möglichkeiten empfindlich hinterher“, erklärt Arteaga. Es müssen deshalb die Strukturen geschaffen werden, die die Bildung großer Versichertenkollektive für ganze Branchen oder eine Vielzahl von Unternehmen ermöglichen. Hierbei müssen die Interessen der Arbeitgeber, die bekanntlich die bAV organisieren und zumeist finanzieren, deutlich in den Vordergrund gerückt werden. „Nur wenn Kostensicherheit, Rechtssicherheit, Flexibilität und eine bessere Übertragbarkeit von Versorgungsversprechen möglich bzw. gewährleistet sind, werden Arbeitgeber Betriebsrenten als von ihnen finanzierte, zusätzliche Sozialleistung gewähren“, so die Erfahrung der Eberbacher.
Genau dies sei jetzt sozialpolitisch geboten, da eine arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente im Interesse aller Arbeitnehmer liege. Die derzeitige Überregulierung im Bereich der bAV müsse daher zumindest für die neu zu schaffenden Versorgungsformen beseitigt werden.
Die bekannten Acht
Um den massiven Ausbau der betrieblichen Altersversorgung zu erreichen, um dabei Kostensicherheit und Bürokratieabbau zu gewährleisten und damit den Interessen vor allem kleiner und mittelständischer Unternehmen zu dienen, wiederholt der Eberbacher Kreis seine 8-Punkte-Forderung aus dem Frühjahr – hier in Kurzfassung aufgelistet:
1. Beschränkung der Arbeitgeberhaftung auf den versprochenen Beitrag (rBZ). Anders als nach geltendem Recht muss dies auch ohne Tarifvertrag möglich sein, wenn in der eigenen Branche ein Tarifvertrag nicht existiert oder keine Tarifbindung besteht.
2. Zulassung von Branchen- oder Verbandslösungen für rBZ, die von Industrie- oder Berufsverbänden als kollektive bAV organisiert werden.
3. Aufbau der Versorgungsansprüche auf Grundlage einfacher Kontenmodelle, die mitkollektiver Kapitalanlage individuelle, flexible Einzahlungen, beliebige Übertragbarkeit und völlige Transparenz ermöglichen.
4. Steuerfreiheit für die Beiträge zu rBZ in deutlich höherem Rahmen als bisher oder, falls fiskalpolitisch wegen befürchteter Steuerausfälle nicht möglich, alternativ Wiedereinführung der Pauschalversteuerung der Beiträge.
5. Gesetzliche Möglichkeit zur Harmonisierung unterschiedlicher Versorgungssysteme im Unternehmen, sofern für die Berechtigten wertgleich.
6. Gesetzlicher Erleichterungen für die Übertragbarkeit von Versorgungsverpflichtungen.
7. Gesetzliche Möglichkeit zur beschleunigten Herstellung von Rechtssicherheit nach Änderung von Versorgungsregelungen im Unternehmen.
8. Beseitigung diverser rechtstechnischer Kollisionen und Widersprüchlichkeiten von VAGund Arbeitsrecht.
BRSG 2.0. ohne echten Impuls
Hintergrund für diese Forderungen: Würden die Leistungen aus dem Bundeshaushalt für die GRV entschlossen zurückgefahren, würden die Renten geringer steigen als heute. Mit flächendeckender Verbreitung der Betriebsrenten ließe sich dies ausgleichen oder gar überkompensieren, hoffen die Eberbacher.
„Die Hoffnung, dass sich tarifungebundene Unternehmen freiwillig dauerhaft einem Altersversorgungs-Tarifvertrag unterwerfen, ist schlicht töricht.“
Das vom Kabinett soeben verabschiedete BRSG 2.0 wird nach Ansicht der Eberbacher eine solche Entwicklung nicht bewirken: Zwar korrigiert es punktuell für einzelne bereits bestehende Betriebsrentensysteme relevante Details. Ein Impuls zur Ausbreitung der Betriebsrenten geht von dem Gesetz jedoch nicht aus. „Insbesondere die im Gesetz angelegte Hoffnung, dass sich tarifungebundene Unternehmen freiwillig dauerhaft einem Altersversorgungs-Tarifvertrag unterwerfen, ist schlicht töricht“, so Arteaga.
Fazit von PENSIONS●INDUSTRIES
Wahrlich keine Fachtagung wie jede andere. Die Finger an vielen Punkten in die Wunde gelegt, um bAV vor allem in Klein- und Mittelbetrieben endlich voranzubringen. Mag manche Idee auf den ersten Blick auch überholt erscheinen – etwa die vorgelagerte Besteuerung freiwillig aufgebauter bAV –, so dürften die allermeisten Reform-Ideen nicht nur überfällig sein, sondern die Kraft haben, auf 80% Prozent Verbreitungsgrad hinzusteuern und auch die Durchschnittshöhe der deutschen Betriebsrenten deutlich anzuheben.
Beispiel Portabilität: Die in Punkt 6. geforderte erleichterte Übertragung von bAV-Ansprüchen bei Wechsel des Arbeitgebers ließe sich so einfach wie bei der GRV regeln: Bei Jobbeginn tritt der Arbeitnehmer ein, der Arbeitgeber meldet ihn zur bAV an und zahlt mit dem Gehalt die Beiträge. Tritt der Arbeitnehmer aus, meldet der Arbeitgeber ihn ab. Eine Versorgungskasse würde alles Weitere übernehmen. Auch hoffnungsvoll: Nachdem am Frühjahrskongress der Eberbacher kaum Sozialpolitiker teilnahmen, sind an diesem Dienstag über ein Dutzend Mitglieder oder Stellvertreter der Bundestagsausschüsse für Finanzen bzw. Arbeit und Soziales dabei – vielleicht geht ja doch noch was in Sachen bAV.