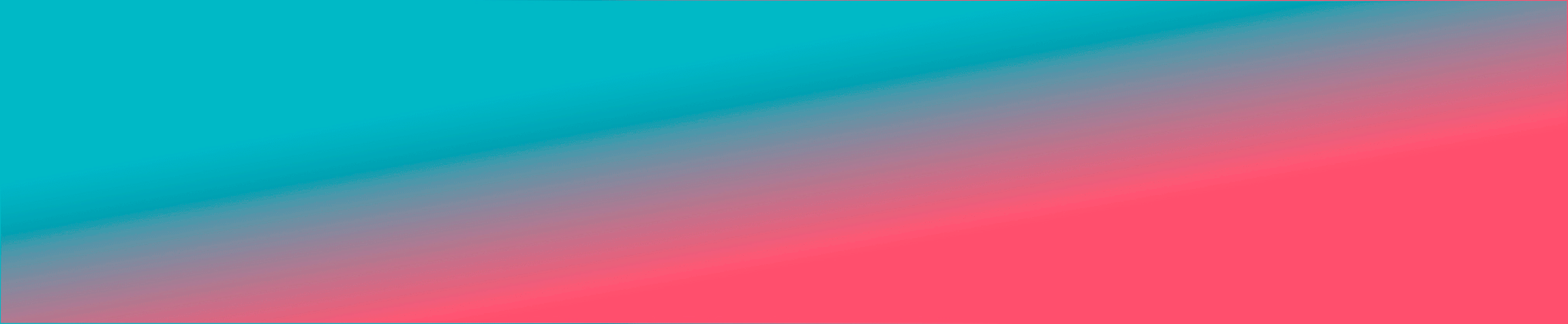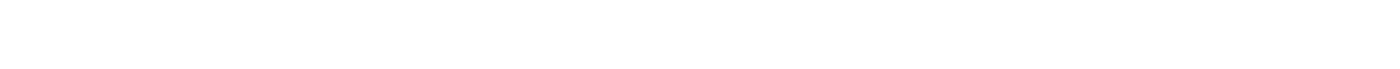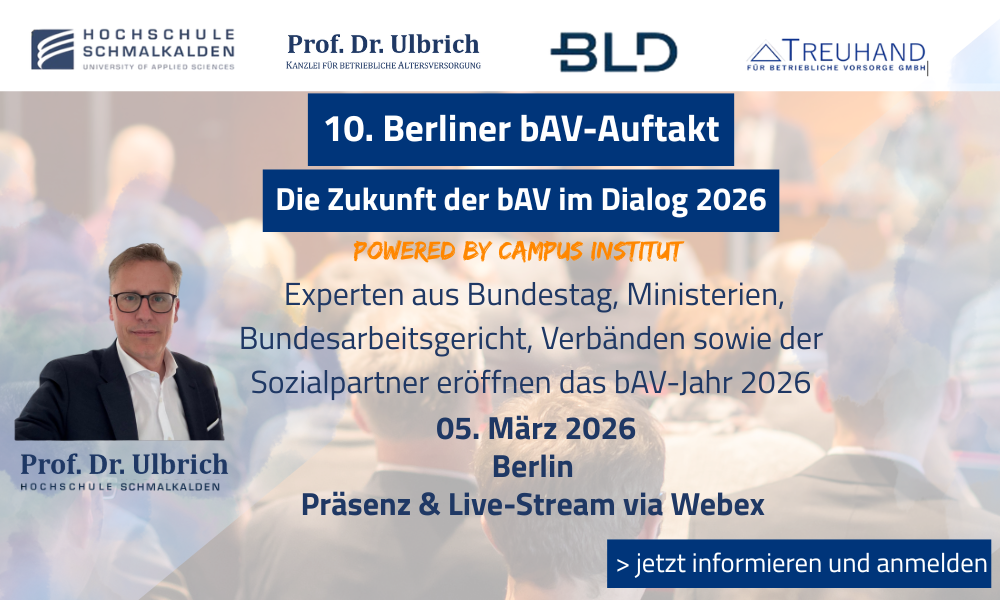US-Präsident Trump schickt mit seiner Hü-Hott-Politik die internationalen Handelsbeziehungen und damit auch die Märkte auf Achterbahnfahrt und strapaziert die Nerven Institutioneller. Die warten zwar überwiegend noch ab – wenn ihnen das Spektakel aber zu bunt wird, könnten sie vor allem bei liquiden Anlagen rasch durchgreifen. Wie reagieren deutsche Pensionsinvestoren? P●I-Autor Jochen Hägele hat sich umgehört. Heute Teil I seines zweiteiligen Beitrages.
Mit Donald Trump haben neue Akronyme Einzug gehalten in die US-Politik. Prominente Kostprobe: das „Taco“-Prinzip. Die Devise „Trump always chickens out“ steht für die Verhandlungstaktik der maximalen Drohung und des ebenso raschen wie überraschenden Rückziehers, auf deutsch am ehesten mit „Schwanz einziehen“ übersetzbar.
Taco dominiert nicht nur die Ukraine- und die Zoll-Politik, sondern auch den Umgang mit Trumps aktuellem Lieblingsgegner – dem Fed-Vorsitzenden Jerome Powell. Am einen Tag steht er offenbar unmittelbar vor der Entlassung, am nächsten Tag will der Präsident nichts dergleichen gesagt haben.

Angriffe auf den Notenbankchef, auf Verbündete und Handelspartner – in dem chaotischen Mischmasch versuchen Großanleger, ihre langfristige Allokation zu sortieren.
Mehrdimensionale Sorgenfalten: hohe Gewichtung trifft auf hohe KGVs
„Investoren überdenken ihre Einstellung zu den USA aus mehreren Gründen“, sagt Daniel Theilen, Leiter der institutionellen Kundenbetreuung beim US-Vermögensverwalter MFS Investment Management.
„Wir hatten in den USA jahrelang ein starkes Gewinn-, aber ein noch stärkeres Kurswachstum.“
Das umfasse mehrere Dimensionen. Zum einen die politisch-persönlichen Aspekte: „Wir erleben eine erratische US-Politik, die heute Entscheidungen trifft und diese morgen wieder zurücknimmt“, sagt Theilen. Viele Anleger würden sich da fragen: „Will ich weiter so hoch in den USA exponiert bleiben, wie ich das die vergangenen Jahre war?“ Denn – und das ist der zweite Aspekt – viele betrachten schon seit längerem die gestiegenen Konzentrationsrisiken mit großer Sorge.

Dafür gibt es Gründe: Im weltweiten Aktienindex MSCI World machen US-Anlagen inzwischen mehr als 70% aus. „Bereits aus Gewichtungsaspekten ist die Abhängigkeit von den USA sehr groß“, so Theilen. Dazu – Punkt drei – sind die Bewertungen in den vergangenen Jahren stark gestiegen: „Wir hatten in den USA jahrelang ein starkes Gewinn-, aber ein noch stärkeres Kurswachstum“, sagt der Investmentexperte. Die US-Bewertungen haben daher überdurchschnittlich zugelegt. Das KGV scheine vielen Investoren schlicht zu hoch. Während das Dax-KGV insgesamt je nach Tagesform bei ca. 19 liegt, notiert es im S&P 500 bei fast 30.
Taktisch wie strategisch substantiell

Die Kapital-Lenker in den deutschen EbAV achten zwar regelmäßig darauf, sich durch kurzfristige Marktfluktuationen und politische Störgeräusche nicht vom langfristigen Kurs ihrer SAA abbringen zu lassen. Doch was aktuell in den USA geschieht, lässt sich bei taktischen und strategischen Allokations-Überlegungen nicht ausblenden. Die Frage, ob es sich dabei um Störgeräusche oder echte Warnsignale handelt, steht im Mittelpunkt.
„Wir stellen fest, dass unsere betrieblichen Anleger die Entwicklungen rund um die US-Wirtschaft und mögliche handelspolitische Belastungen sehr genau verfolgen“, sagt Gabriel Kolaczewitz, bAV-Spezialist bei Flossbach von Storch in Köln.

Ähnliches berichtet Michael Kreibich, Head of Institutional Clients der Berenberg Wealth and Asset Management: Insgesamt hätten sich bei der Beratung der Mandanten zur strategischen Ausrichtung der Kapitalanlage die relevanten Themen über die vergangenen Jahre stark gewandelt. Nach Niedrigzinsen, ESG und Zins- sowie Inflationsschock stehe nun die Politik oft im Mittelpunkt. Die Wahl Trumps Ende 2024 zum Präsidenten der USA habe zu erheblicher Verunsicherung geführt, welche auch weiterhin Bestand hat, so Kreibich, und „kombiniert mit einer immer ausgeprägteren Dynamik an den Kapitalmärkten ist dies aktuell ein Thema, über das wir sehr häufig mit unseren Mandanten sprechen: Der Umgang mit Unsicherheit bei der Entwicklung und Steuerung der Kapitalanlage.“
US-Aktien: Ja, aber mit angezogener Handbremse in Bonn …
US-Engagements stehen traditionell besonders bei Aktien im Fokus: Nachgefragt bei Christian Mehlinger. Ihn lassen die aktuellen politischen Turbulenzen nicht an den langfristigen Perspektiven für US-Aktien zweifeln. Der Head of Group Pensions bei der DHL Group ist überzeugt: „Die USA werden langfristig prosperieren.“ Denn wichtige Argumente würden weiter für die USA sprechen: „Demographie, Technologieführerschaft, Konsumenten, weniger Regulierung und niedrige Energiekosten“, zählt der DHL-Group-Pensionsmanager auf.
Bei der US-Allokation ist das DHL-CTA dennoch strukturell eher konservativ unterwegs, erklärt Mehlinger: „Wir verwenden einen eigenen Index. US-Aktien haben dabei zwar auch ein hohes Gewicht, aber nicht so hoch wie etwa im MSCI World.“

In Europa erkennt der Bonner aufgrund der staatlichen Investitionsoffensive ein zartes Pflänzchen, was das Wachstum angeht.Von einem langfristigen wirtschaftlichen Outperformance-Potenzial gegenüber den USA sei jedoch nichts zu erkennen. Auch die Konturen des aktuellen Zoll-Deals dürften die wirtschaftliche Waagschale nicht in Richtung EU kippen lassen, so Mehlinger.
… und in Wiesbaden auch

Auch Werner Schneider, Vorstand der Soka-BAU, steuert mit dem Asset-Management-Team um Tobias Bockholt das Gesamtportfolio mit ruhiger Hand. Dabei geht man nach einem realwirtschaftlich-orientierten Ansatz vor: „Unsere Asset-Allokation ist weitgehend vom Anteil am weltweiten BIP getrieben“, so Schneider. Das hat deutliche Auswirkungen auf das Gewicht von US-Aktien, wie er erklärt: „Für die USA ergibt sich bei einer BIP-Gewichtung über alle Anlageklassen hinweg ein Gewicht von 30 bis 40%. Gegenüber den marktkapitalisierungsgewichteten Indizes betrachtet sind wir also deutlich untergewichtet in den USA, und das seit langem.“ Damit fühlt er sich auch wohl: „Wir sehen aktuell keinen zwingenden Handlungsbedarf im Hinblick auf unsere US-Aktienallokation“. Würde man Grund zum Einschreiten sehen, seien aber auch entschlossene Kurskorrekturen möglich. So wie etwa in China: „Da haben wir vor etwa einem Jahr entschieden, das Exposure im Vergleich zu unserer Benchmark insgesamt weiter deutlich abzubauen“, erklärt Schneider.
Ohne geht nicht
Thorsten Wellein ist als Portfoliomanager in Kontakt mit zahlreichen Investoren. Der Experte der Faros Consulting beobachtet zwar keine drastischen Reduzierungen der US-Allokation, aber durchaus eine qualitative Umschichtung und stärkere Diversifizierung bei Neuanlagen. Viele Investoren würden ihre Allokation schrittweise reduzieren und anpassen. Generell sei ein Nettoabfluss aus den USA zugunsten von Europa und eingeschränkt Asien festzustellen. US-Aktien, insb. aus dem Bereich der Technologieführer wie Nvidia und Apple, hält Wellein aber für unverzichtbar. „Hier sehen wir keine Alternativen zu den großen KI- und Plattform-Unternehmen“, so Wellein.
Grundsätzliches gilt weiter, doch der Rahmen ändert sich schnell
Eine pauschale Zurückhaltung gegenüber US-Exposure empfiehlt man auch bei Flossbach von Storch nicht. „Eine einseitig defensive Positionierung gegenüber den USA könnte bedeuten, sich die Möglichkeit auf attraktive mittel- bis langfristige Renditen zu verbauen“, erklärt bAV-Spezialist Kolaczewitz. Ähnlich wie Mehlinger sieht auch er trotz aller aktuellen Herausforderungen in der US-Volkswirtschaft weiter eine der dynamischsten weltweit – getragen von Innovationskraft, Wettbewerbsfähigkeit und einer Vielzahl erfolgreicher Unternehmen. Zudem sei breite Diversifikation wichtig, auch die jüngste Zoll-Einigung mit den USA zeige, wie rasch sich die Rahmenbedingungen ändern könnten.
Das höhere Zollniveau stelle ohne Frage einen wirtschaftlichen Gegenwind dar und dürfte das Wachstum tendenziell bremsen. „Gleichwohl sind unsere Portfolios darauf ausgerichtet, unterschiedlichste Szenarien zu überstehen und im Idealfall gestärkt aus Marktverwerfungen hervorzugehen“, so Kolaczewitz. Auch die Märkte selbst hätten bislang gelassen auf die jüngsten Zoll-Einigungen reagiert. In der Regel würden konkrete Fakten stärker wirken als Spekulationen über mögliche Folgeeffekte. Das Ergebnis der Deals scheine insgesamt verkraftbar und weniger marktbewegend als andere makroökonomische Faktoren.
Entspannt bei Anleihen, sei es mit Hedging …
Bei Anleihen sieht die Sache mit der US-Allokation etwas anders aus. Der US-Anteil ist bei Fixed Income in den meisten EbAV-Portfolios deutlich geringer als bei Aktien. Vor allem nutzen die meisten Investoren hier umfassende Währungsabsicherungen. „Bei Anleihen sind wir meistens währungsgehedgt unterwegs“, erklärt auch Mehlinger. Die US-Verschuldung und der potenzielle weitere Anstieg der Treasury-Renditen bereiten ihm keine schlaflosen Nächte. „Für uns sind die Cashflows, also die Kupon- und Tilgungszahlungen, entscheidend“, so Mehlinger, und „wenn die Anleihenkurse etwas nachgeben können wir das aus Sicht des IFRS-Bilanzierenden verschmerzen, nicht zuletzt, weil dann meist auch die DBO nachgibt.“
Auch, dass die Ratingagentur Moody’s zuletzt S&P folgte und die langfristigen externen Verbindlichkeiten der USA vom begehrten Tripple-A auf AA zurückstufte, bewertet er noch nicht als alarmierend. Anders wäre das im Fall einer deutlichen Kreditverschlechterung, die eine Neubewertung der Situation auslösen würde. „Aber die sehen wir zur Zeit nicht“, sagt der Pensionschef.
… oder ohne
Gelassen angesichts der jüngsten Bewegungen bei US-Renditen und Dollar ist auch Soka-BAU-Kapitalanlagevorstand Schneider: „Wir haben auf der Passiv-Seite eine Duration von mehr als 30 Jahren, vor dem Hintergrund halten wir häufiges Umschichten nicht für angemessen.“
„Die Tail Risk-Absicherung war am Ende nicht mehr ökonomisch sinnvoll.“
Eine Besonderheit der Soka-BAU: Im Gegensatz zu vielen anderen Investoren sichern die Wiesbadener Währungen grundsätzlich nicht ab. „Das hat auch damit zu tun, dass wir als wachsende Kasse ausreichend stille Reserven und Liquidität haben und Investments in Fremdwährung auch durch Ausschüttungen in denselben Währungen bedienen können“, sagt Schneider, und „würden wir in US-Renten nicht währungsgesichert investieren, würde sich das langfristig für uns nicht lohnen.“
Bis vor etwa eineinhalb Jahren nutzte man bei der Soka-BAU auch Tail Risk Hedges für das liquide Portfolio: „Wir haben uns aber dazu entschlossen, diese aufzulösen“, sagt Werner Schneider. In die Tail Risk Hedges war das Portfolio nur einmal im Zuge der Corona-Krise hineingerutscht. „Die Absicherung war am Ende nicht mehr ökonomisch sinnvoll für uns“, ist Schneiders Erfahrung.
Teuer

Die hohen Währungsabsicherungskosten auf Grund des Zinsdifferentials belasten derzeit in der Tat die Renditen vieler Dollaranleihen. Dazu sind die Auswirkungen der US-Politik auf das lange Ende der Kurve ungewiss. Die steigende Verschuldung könne durchaus zu deutlich höheren Zinsen führen, so Faros-Experte Wellein. Für Euro-Investoren hält er US-Anleihen daher aktuell für nicht attraktiv; insb. das hohe Währungsabsicherungskosten neutralisiere die nominal höheren US-Renditen.
Kein Dollarcrash in Sicht
Ungesichert verloren viele Bestände allein auf der Währungsseite seit Jahresbeginn in der Spitze mehr als 13%. MFS-Kundenbetreuer Theilen trifft immer häufiger Anleger, die neuerdings über Dollar-Hedges auch für ihre Aktienallokationen nachdenken. Doch hier ist die Frage, wie tief der Dollar noch sinken wird.
Dass die fundamentalen Risiken für den US-Dollar und die Treasury-Märkte zunehmen, glaubt etwa Wellein von Faros Consulting. „Wir sehen eine gestiegene Vorsicht, wie viel Investitionen des Portfolios künftig in den USA und dem USD-Risiko unterliegen sollen“, sagt Wellein.
„Ich halte nichts von Thesen, dass der Dollar als Reservewährung kurz- bis mittelfristig abgelöst werden könnte.“
Gelassen ist in diesem Punkt Ludovic Subran, Allianz-Chefvolkswirt und CIO bei Allianz Investment Management. Er bestätigt zwar: „Die jüngsten Kapitalmarktströme bestätigen, dass der Appetit der Anleger auf den US-Dollar nachgelassen hat.“ Er sieht aber keine Anzeichen für einen Ausstieg auf breiter Front. Ein Großteil der jüngsten Abwertung sei eher auf eine veränderte Positionierung als auf umfangreiche Abflüsse zurückzuführen. „Entscheidend ist, dass der Mangel an praktikablen Alternativen die Nachfrage nach dem Dollar aufrechterhält“, sagt Subran.
Auch Mehlinger erwartet keinen Übergang der Dollarkorrektur in eine Dollarkrise: Zu stark die Position des Greenback und der USA an den Kapitalmärkten. „Ich halte nichts von Thesen, dass der Dollar als Reservewährung kurz- bis mittelfristig abgelöst werden könnte“, so Mehlinger.
Ende des ersten Teils des Beitrages. Der zweite, der sich des Themas vornehmlich unter dem Gesichtspunkt der Assets auf den Private Markets widmet, folgt in Kürze auf der Schwesterplattform ALTERNATIVES●INDUSTRIES.
Das zur heutigen Headline anregende Kulturstück findet sich hier.