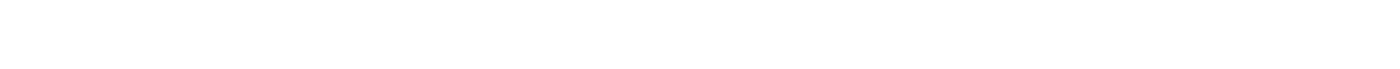Nach Ende der Gesetzgebung nähert sich das Parkett schrittweise der Umsetzung von Sozialpartnermodell und Zielrente. Auf einer Konferenz in Köln tauschten Experten nun erneut Positionen und Standpunkte aus. Auf dem Podium Stellung bezog auch die Aufsicht. Rita Lansch war für LEITERbAV dabei.
Vergangenen Mittwoch in Köln am Rhein. Euroforum-Tagung Die Zielrente – Entwicklung, Umsetzung und Steuerung des Sozialpartnermodells. Experten diskutieren in verhältnismäßig kleiner Runde. Die BaFin ist dabei, vertreten durch Dietmar Keller.
Der Leiter des BaFin-Grundsatzreferates für Einrichtungen der bAV – der bereits vor knapp einem Jahr auf einer Konferenz der Aon Hewitt aufsichtsrechtliche Grundzüge des sich damals abzeichnenden SPM skizziert hatte – forderte eingangs seines Vortrages das Parkett zum Dialog auf. Quasi als Startschuss für Konsultationsgespräche zur Zielrente bot der Beamte Tarifpartnern und potenziellen Anbietern das Gespräch an. Zugleich versicherte Keller den Teilnehmern: „das Sozialpartnermodell genießt hohe Priorität bei der BaFin.“
Die Schlüsselrolle der Tarifparteien…
Die Rolle der BaFin ist laut Keller kaum zu verstehen, ohne zuvor einen Blick auf die Rolle der Tarifparteien zu werfen. Kernfrage hier: Welche Wege der Beteiligung stehen zur Verfügung? Da sei zunächst mal der Tarifvertrag (TV) selbst. Dort müssten Grundzüge geregelt werden, etwa zum Sicherungsbeitrag. „Allerdings hat der Gesetzgeber nicht die Erwartung gehegt, dass nun alle Entscheidungen im TV abschließend getroffen werden“, stellte Keller klar. Deswegen sei in der PFAV an zwei Stellen (§ 39 und § 42) von einer Vereinbarung zwischen den TV-Parteien und den Einrichtungen die Rede. Keller: „Alle Grundsatzentscheidungen, die nicht im TV bereits geregelt sind, müssen dann in der Durchführungsvereinbarung geregelt werden.“
Nach den zu treffenden Grundsatzentscheidungen müssen die TV-Parteien sich auch laufend an der Steuerung beteiligen. Dies kann, sofern möglich, in einem Organ der durchführenden Einrichtung erfolgen oder einer Art Beirat. Die in den Beirat entsandten Personen müssen jedoch nicht befürchten, dem gestrengen „Fit&Proper“-Test unterzogen zu werden, den die BaFin von Aufsichtsräten, bspw. von Versicherungen, verlangt, insbesondere weil der Beirat keine Entscheidungsbefugnisse über das operative Geschäft der Einrichtung ausüben wird und auch nicht die Rolle eines Aufsichtsrates übernimmt. Die Leitung der Einrichtung obliegt dem Vorstand, der seine Entscheidungen letztverantwortlich trifft.
…und ihre Gestaltungsspielräume sowie…
Im Kern muss von den TV-Parteien entschieden werden, wie mit dem Verhältnis zwischen Chancen und Risiken der rBZ umzugehen ist. Dabei gibt es reichlich Gestaltungsspielräume. So wäre es möglich, die Kapitalanlagen der Anwärter und Rentner zu separieren und unterschiedliche Vorgaben für die Anspar- und die Rentenbezugsphase zu formulieren, erläuterte Keller.
Spielraum haben die Partner auch bei der Ausgestaltung der kollektiven Puffer. Diese können insbesondere aus Sicherungsbeiträgen des Arbeitgebers gebildet und zum Ausgleich von Schwankungen für die Anwärter und zur Vermeidung von Rentenkürzungen für die Rentner eingesetzt werden.
…die Rolle der BaFin
Die TV-Parteien geben der durchführenden Einrichtung die Grundsätze vor, wobei der zwingende aufsichtsrechtliche Rahmen eingehalten werden muss. An den grundsätzlichen Vorgaben der TV-Parteien muss sich auch das Risikomanagement der durchführenden Einrichtung orientieren. Und die Aufsicht wacht nicht zwingend darüber, dass die Anwartschaften stabil bleiben oder die Renten nicht gekürzt werden, betonte Keller weiter. Die BaFin prüfe, ob die durchführenden Einrichtungen die rBZ entsprechend den Vorgaben der TV durchführen und dabei die zwingenden aufsichtsrechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Die Anstalt erhalte von der durchführenden Einrichtung zur Erfüllung ihrer Aufgabe umfangreiche Informationen und Berichte – sowohl bei Einführung der rBZ (z.B. den TV, die Vereinbarungen, die Pensionspläne sowie die technischen Berechnungsgrundlagen) als auch laufend.
Eigenmittelvorschriften: geringer
Keller erinnerte daran, dass nach der Gesetzesbegründung das Garantieverbot zu vergleichsweise geringen Eigenmittelanforderungen führt. Damit wollte der Gesetzgeber erreichen, dass die rBZ grundsätzlich allen Pensionsfonds, Pensionskassen und Lebensversicherungsunternehmen offensteht. Auch sollte dadurch die Neugründung von Einrichtungen erleichtert werden. Letztlich sollte das Wettbewerbsmoment gestärkt werden.
Es mag auf den ersten Blick erstaunen, so Keller, dass im BRSG keine gesonderten Eigenmittelvorschriften für die rBZ zu finden sind. Diese waren jedoch nicht nötig, da die rBZ als fondsgebundene Lebensversicherung eingestuft wurde und dadurch auf die bestehenden Vorschriften für Produkte ohne Garantien zurückgegriffen werden kann. Die Eigenmittelvorschriften für EbAV und Lebensversicherungsunternehmen richten sich zwar nach unterschiedlichen Aufsichtsregimen (EbAV-RL bzw. Solvency II-RL). Im Ergebnis sei jedoch mit niedrigen Eigenmittelanforderungen zu rechnen.
Informationen an die Versorgungsberechtigten: mehr
In der PFAV finden sich Informationspflichten gegenüber Anwärtern und Leistungsempfängern, die den Besonderheiten der rBZ geschuldet sind und zusätzlich zu den bestehenden Informationspflichten gelten. Wichtig sei insbesondere, dass die Informationen an die Anwärter und Rentner einen ausdrücklichen Hinweis enthalten, dass die mitgeteilten Beträge nicht garantiert sind. Hervorzuheben sei auch, dass die Informationen an die Versorgungsberechtigten konsistent sein müssen mit dem Risikomanagement der durchführenden Einrichtung.
Abschließend wies Keller darauf hin, dass die Umsetzung der EbAV-II-Richtlinie wohl weitere Informationspflichten mit sich bringen werde, die für die rBZ relevant sein werden. So sehe die Richtlinie vor, dass Leistungsempfänger über Leistungskürzungen vorab mit einer Frist von drei Monaten zu informieren sind und auch Kosten aufgeschlüsselt werden müssen. Schließlich verlange die EbAV-II-Richtlinie Projektionsrechnungen zur Versorgungsleistung, und zwar einmal im „Best-Estimate-Szenario“ und einmal für einen „ungünstigen Fall“.
Teil IV mit Aussagen weiterer Vortragender (im Telegrammstil) findet sich hier.