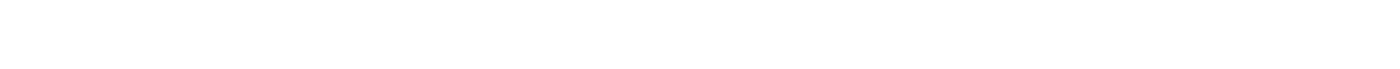In zwei Vorinstanzen hatte der Betriebsrenter verloren, gab nicht auf, zog vor das höchste deutsche Arbeitsgericht – und erzielte einen wichtigen Teilerfolg. Der Dritte Senat nutzte die Gelegenheit, seine bekannte Drei-Stufen-Theorie mit Blick auf die Neuordnung von Konzernversorgungswerken zu schärfen. Ein Fazit: Die Sache bleibt anspruchsvoll, und Arbeitgeber sollten ein gutes Langzeitgedächtnis haben. Niclas Bamberg analysiert das nun jüngst veröffentlichte Urteil.
Das BAG hat in seiner richtungsweisenden Entscheidung Az 3 AZR 247/23 vom 2. Juli 2024 die Voraussetzungen klargestellt, unter denen eine Verschlechterung von Versorgungszusagen in einem Konzernversorgungswerk zulässig ist.

Im Mittelpunkt der Entscheidung stand die sog. „Drei-Stufen-Theorie“, das von der Rechtsprechung entwickeltes Prüfmodell zur Differenzierung der Anforderungen an Eingriffe in betriebliche Altersversorgung nach Eingriffstiefe. Die Entscheidung beleuchtet, wie das Vertrauen der Arbeitnehmer in ihre Versorgungsansprüche gewahrt werden kann, während Konzernarbeitgeber zugleich wirtschaftliche Flexibilität behalten.
Der Fall: Vom Gesamtversorgungssystem zum Festbetragssystem
Der Ausgangsfall hatte seinen Ursprung in einem komplexen Konzernversorgungswerk, dessen Grundlagen in den 1970er Jahren geschaffen wurden:
Der Kläger, ein ehemaliger Mitarbeiter, erhielt seine Betriebsrente ursprünglich nach den Regelungen einer Konzernbetriebsvereinbarung von 1977 (PO 1977). Diese sah ein dienstzeit- und gehaltsabhängiges Gesamtversorgungssystem vor, das auch die gesetzliche Rente berücksichtigte.
Zum 1. Januar 1987 wurde diese Ordnung durch eine neue Pensionsordnung (PO 1987) ersetzt. Mit ihr führte der Arbeitgeber ein Festbetragssystem ein, das unabhängig von der gesetzlichen Rente war und für die meisten Beschäftigten eine geringere Versorgung bedeutete. Der Kläger argumentierte nun, dass diese Änderung unzulässig sei und forderte eine Berechnung seiner Rente ausschließlich nach der alten Regelung. Für ihn hätte dies eine monatliche Erhöhung seiner Betriebsrente um über 500 Euro bedeutet. Die Beklagte hingegen begründete die Neuordnung mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten, insb. einem drastischen Anstieg der Pensionsrückstellungen im Konzern.
Zentrale Streitfrage: die Rechtmäßigkeit der Verschlechterung
Das Verfahren drehte sich um die Frage, ob die Ablösung der alten Pensionsordnung durch die neue zulässig war. Dabei standen zwei Kernpunkte im Fokus:
-
Das Ablösungsprinzip im Betriebsverfassungsrecht: Nach diesem Grundsatz kann eine neue Betriebsvereinbarung eine ältere ersetzen – auch wenn sie für die Arbeitnehmer ungünstiger ist.
-
Die Anforderungen der Besitzstandsrechtsprechung des BAG: Diese schützt die Anwartschaften und Ansprüche der Arbeitnehmer vor willkürlichen Eingriffen.
Die Vorinstanzen hatten die Klage des ehemaligen Mitarbeiters abgewiesen. Das BAG hob jedoch das Berufungsurteil auf und verwies den Fall zurück an das LAG Hamm. Es verlangte eine umfassendere Prüfung der Rechtfertigungsgründe und legte dabei besonderen Wert auf die Anwendung der Drei-Stufen-Theorie.
Die Drei-Stufen-Theorie: Prüfmaßstab für Eingriffe
Das BAG bekräftigte, dass die Drei-Stufen-Theorie auch bei Konzernversorgungswerken der geeignete Maßstab für die Beurteilung verschlechternder Neuordnungen ist. Dieses Schema differenziert nach der Intensität des Eingriffs:

Noch nicht erdiente Zuwächse: Für künftige, noch nicht erdiente Versorgungsansprüche sind Eingriffe unter erleichterten Bedingungen möglich. Der Arbeitgeber muss sachlich-proportionale Gründe vorlegen, die die Änderung rechtfertigen.
Anwartschaften: Eingriffe in bereits erdiente Anwartschaften erfordern gewichtige sachliche Gründe. Die Eingriffe müssen angemessen und verhältnismäßig sein, um das Vertrauen der Arbeitnehmer zu schützen.
Bestandsrenten: Änderungen an laufenden Renten sind nur in Ausnahmefällen zulässig. Hier sind die Hürden besonders hoch, da die Betroffenen keine Möglichkeit mehr haben, die Kürzungen durch weitere Arbeitsleistung auszugleichen.
Der Dritte Senat stellte klar, dass die Theorie weiterhin geeignet ist, die Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Einklang zu bringen, denn sie ermöglicht wirtschaftliche Flexibilität, ohne den Vertrauensschutz der Beschäftigten zu untergraben.
Sachlich-proportionale Gründe im Konzernkontext
Ein zentrales Element der Entscheidung – hier ging es also um die erste Stufe – war die Frage, welche Gründe eine verschlechternde Neuordnung rechtfertigen können. Das BAG betonte, dass bei konzernweiten Versorgungswerken die wirtschaftliche Gesamtsituation des Konzerns maßgeblich ist. Lokale wirtschaftliche Schwierigkeiten einzelner Konzerngesellschaften sind nicht ausreichend.
„Pauschale Hinweise auf steigende Pensionsrückstellungen oder wirtschaftliche Probleme reichten nicht aus.“
Andererseits müssen auch Arbeitnehmer einer Konzerngesellschaft, der es wirtschaftlich gut geht, die Neuordnung gegen sich gelten lassen, wenn auf Konzernebene entsprechende Gründe hierfür vorliegen. Der Arbeitgeber muss insoweit schlüssig darlegen, dass:
-
wirtschaftliche Schwierigkeiten im Konzern bestehen und
-
die Neuordnung Teil eines umfassenden Sanierungskonzepts ist und
-
die Verschlechterung der Versorgungszusage im Verhältnis zur wirtschaftlichen Notwendigkeit steht.
Das Gericht verlangte von der Beklagten eine detaillierte Dokumentation der Entscheidungsgründe (zur Erinnerung: Die neue PO war im Jahre 1987 eingeführt worden!). Pauschale Hinweise auf steigende Pensionsrückstellungen oder wirtschaftliche Probleme reichten nicht aus. Stattdessen müssen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten konkret dargelegt und die proportionalen Einsparungen nachvollziehbar begründet werden.
Mitbestimmung und Vertrauensschutz
Ein weiteres wichtiges Thema war die Mitbestimmung des Konzernbetriebsrats. Das BAG erkannte an, dass die Zustimmung des Betriebsrats für die Ausgewogenheit der Neuordnung spricht. Diese Zustimmung ersetzt jedoch nicht die gerichtliche Prüfung der tatsächlichen Rechtfertigungsgründe.
Das Vertrauen der Arbeitnehmer in die ursprünglichen Versorgungszusagen spielte ebenfalls eine zentrale Rolle. Die Beschäftigten hätten ihre Arbeitsleistung im Vertrauen darauf erbracht, dass die zugesagten Leistungen grundsätzlich Bestand haben. Dieses Vertrauen sei vom ersten Arbeitstag an schützenswert, unabhängig von Wartezeiten oder kurzen Beschäftigungsdauern.
Praktische Konsequenzen: Dokumentation und Prüfung
Die Entscheidung verdeutlicht, dass Neuordnungen von Versorgungswerken hohe Anforderungen erfüllen müssen. Arbeitgeber sollten besonders auf folgende Punkte achten:
-
Umfassende Dokumentation: Alle wirtschaftlichen und organisatorischen Gründe für eine Neuordnung müssen nachvollziehbar festgehalten werden. Diese Dokumentation ist auch Jahre, ggf. durchaus Jahrzehnte später noch relevant, da betroffene Arbeitnehmer ihre Ansprüche lange nach der Umsetzung gerichtlich geltend machen können.
-
Prüfung der Verhältnismäßigkeit: Die Verschlechterung der Versorgungszusage muss in einem angemessenen Verhältnis zur wirtschaftlichen Notwendigkeit stehen. Der Arbeitgeber muss darlegen, dass alternative Maßnahmen geprüft wurden und die Einsparungen proportional zur Belastung der Arbeitnehmer sind.
-
Einbindung des Betriebsrats: Die Zustimmung des Betriebsrats ist wichtig, entbindet den Arbeitgeber jedoch nicht von seiner Darlegungs- und Beweislast.
-
Langfristige Perspektive: Gerade bei Versorgungszusagen, die über Jahrzehnte wirken, ist eine vorausschauende Planung und regelmäßige Überprüfung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit unerlässlich.
Fazit: Balance zwischen Flexibilität und Schutz
Mit dem Urteil Az 3 AZR 247/23 stärkt das BAG den Schutz der Arbeitnehmer vor willkürlichen Eingriffen in ihre Versorgungsansprüche und setzt gleichzeitig klare Leitlinien für die Flexibilität von Arbeitgebern. Die Drei-Stufen-Theorie bleibt ein verlässlicher Prüfmaßstab für die rechtliche Bewertung solcher Neuordnungen.
Arbeitgeber müssen sich darauf einstellen, dass jede Verschlechterung von Versorgungszusagen detailliert begründet und dokumentiert werden muss. Für Arbeitnehmer bietet das Urteil Sicherheit: Ihre Ansprüche sind geschützt, solange keine hinreichenden sachlichen Gründe für eine Änderung vorliegen.
Vorinstanzen:
ArbG Bochum, Urteil 3 Ca 553/21 vom 12. Januar 2022
LAG Hamm, Urteil 4 Sa 124/22 vom 27. September 2023
Das LAG Hamm wird nun vermutlich bis Mitte 2025 neu zu entscheiden haben.
Der Autor ist Head of Legal & Tax der adesso benefit solutions GmbH in Dortmund.
Das zur heutigen Headline anregende Kulturstück findet sich hier.

Anm. der Redaktion: Mit diesem Beitrag gehen PENSIONS●INDUSTRIES / ALTERNATIVES●INDUSTRIES in die Weihnachtspause. Ab der zweiten Januarhälfte nimmt die Redaktion die Arbeit wieder auf – nur Kassandra, die wird sich auch zwischendurch melden. Verlassen Sie sich drauf!