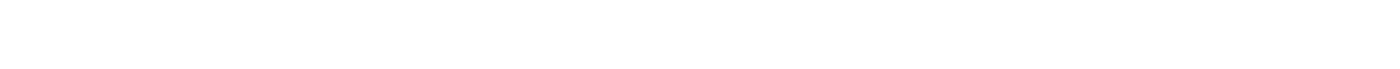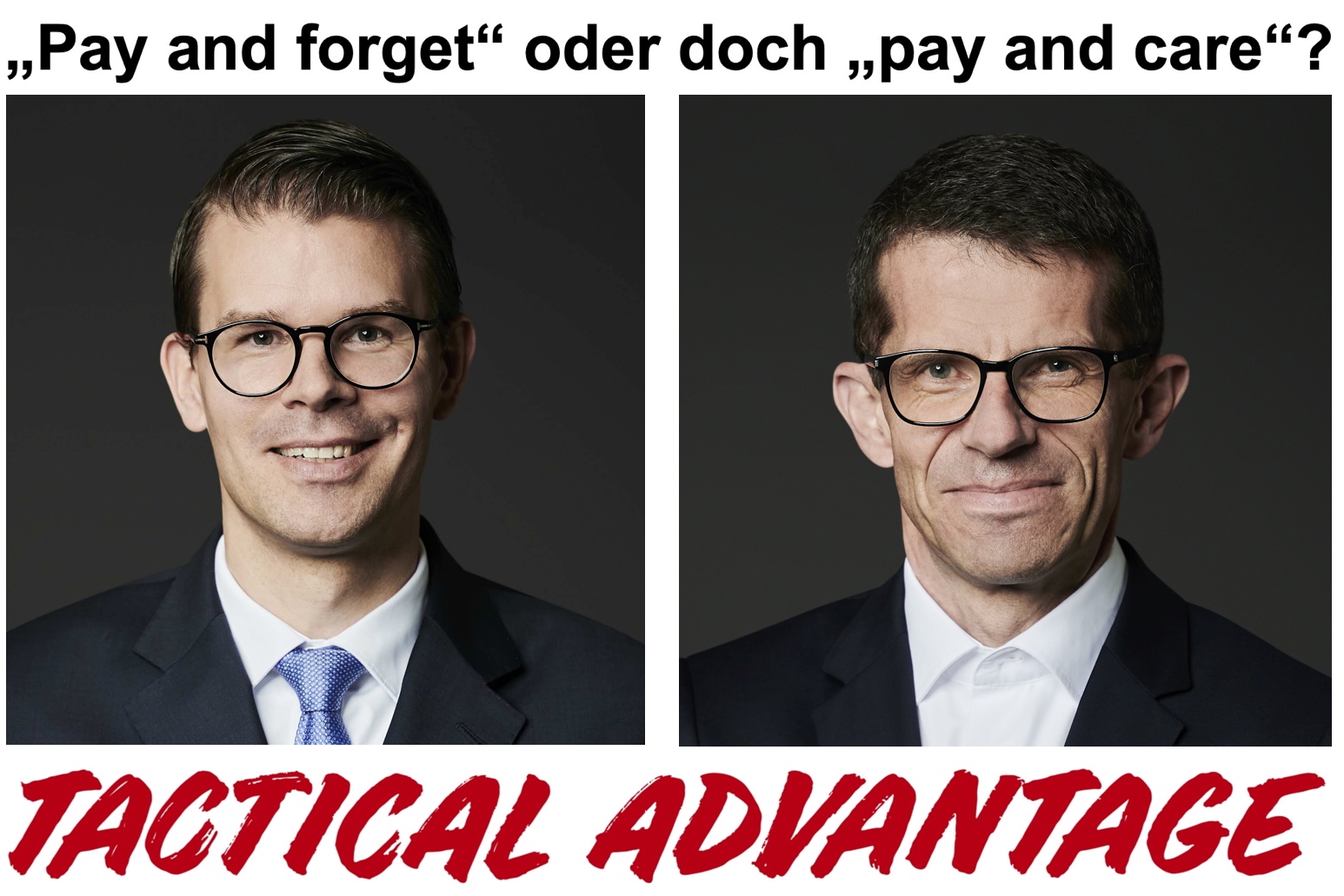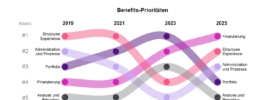Darf ein Arbeitgeber bei der Ermittlung bAV-relevanter Grenzwerte zur Verwaltungsvereinfachung pauschalisieren? Oder muss er auf die Verhältnisse des einzelnen Arbeitnehmers abstellen? Dafür ging ein Betriebsrenter durch die Instanzen, der zwar nicht mehr in der Kirche ist, bei dem aber die Kirchensteuer fiktiv einberechnet wurde. Vor Gericht gab es einen Sieg der Schlankheit – der mit einem Vergleich begründet wurde.
Am 21. Januar hat es in Erfurt einen kleinen Großkampftag des Dritten Senats gegeben. In einem hier dokumentierten Fall war der PSV in der der Frage der Verjährung seiner Ansprüche erfolgreich. In einem anderen ging es darum, ob in der bAV ein fiktiver Abzug der Kirchensteuer trotz Austritt zulässig ist.
Wie die Longial in einem aktuellen Beitrag über das Urteil 3 AZR 100/24 erläutert, zeigte ein Arbeitnehmer wenig Verständnis, als sein Arbeitgeber im Rahmen des pauschalierten Ansatzes Kirchensteuern berücksichtigt hat, obwohl der Ruheständler schon viele Jahre nicht mehr Mitglied der Kirche war. Im Einzelnen der Fall in den Worten der Longial (gerafft):
Vorzeitiger Bezug, Gesamtbetriebsvereinbarung und …
Der ehemalige Arbeitnehmer war mit der Höhe der seitens seines ehemaligen Arbeitgebers berechneten Betriebsrente nicht einverstanden und machte für den Zeitraum vom 1. April 2016 bis zum 28. Februar 2023 die Zahlung einer weiteren Zusatzversorgung in Höhe von 70,91 Euro monatlich geltend.

Seine Versorgungsrechte richteten sich nach einer Gesamtbetriebsvereinbarung über Zusatzversorgungsleistungen: Hiernach hatte er ab dem 1. April 2016 Anspruch auf Zahlung einer Zusatzversorgung, weil er seitdem eine vorzeitige GRV-Rente bezog.
Die Gesamtbetriebsvereinbarung sah vor, dass ein solcher Anspruch besteht, falls durch die Ruhestandsbezüge nicht mehr als 75% des versorgungsfähigen Einkommens, höchstens jedoch 100% des Nettoeinkommens erreicht werden. Dazu zählten die GRV-Rente, die Leistungen des Beamtenversicherungsvereins des Deutschen Bank- und Bankiergewerbes a.G. und sonstige Versorgungsleistungen, die nicht überwiegend auf Beiträgen des Arbeitnehmers beruhen.
… fiktive Netto-Berechnung
Als anrechenbare Rente gilt die jeweilige Bruttorente vor Abzug etwaiger Steuern, Abgaben und Beiträge, jedoch ohne etwaige Zuschüsse zur Krankenversicherung der Rentner. Ferner wurde in der Gesamtbetriebsvereinbarung geregelt, dass vom zuletzt bezogenen regelmäßigen monatlichen Bruttoeinkommen die Steuern einheitlich nach der Steuerklasse III/0 der Lohnsteuertabelle (Monatslohn), die Arbeitnehmeranteile zum Renten- und Arbeitslosen- sowie zum Krankenversicherungsbeitrag nach dem vom BMAS veröffentlichten durchschnittlichen Beitragssatz der Ortskrankenkassen abgezogen werden. Die Berechnung des Nettoeinkommens erfolgte somit fiktiv, was zuletzt auch zwischen den Parteien unstreitig war – eben abgesehen von der Berücksichtigung der Kirchensteuer.
Der Ex-Arbeitnehmer vertrat nun die Ansicht, dass bei der Berechnung der Obergrenze der Nettogesamtversorgung ein Abzug der Kirchensteuer zu unterbleiben habe – jedenfalls bei Versorgungsempfängern, die nicht Mitglied der Kirche seien, wie er selbst.
Aufgrund der dadurch erhöhten Nettobegrenzung steige sein Zusatzversorgungsanspruch um besagte 70,91 Euro monatlich. Er argumentierte, die Berechnung des fiktiven Nettoeinkommens unter Berücksichtigung der Kirchensteuer führe darüber hinaus zu einer ungerechtfertigten Ungleichbehandlung.
Abgeblitzt mit …
In Erfurt unterlag der Mann, die Revision gegen das Urteil des LAG Düsseldorf 12 Sa 738/23 vom 13. März 2024 wurde zurückgewiesen. Der Dritte Senat entschied, dass die Regelung des ehemaligen Arbeitgebers zur Berechnung des fiktiven Nettoentgelts wirksam und daher nicht zu beanstanden ist. Die negative Religionsfreiheit der betroffenen Versorgungsberechtigten – also die Möglichkeit, keiner Religionsgemeinschaft anzugehören – sieht der Senat durch die fiktive Berücksichtigung der Kirchensteuer als pauschalen Abzugsposten bei der Berechnung der Nettolohnobergrenze nicht beeinträchtigt. Die Pauschalierung unter Abzug auch fiktiver Kirchensteuer dient vielmehr der Verwaltungsvereinfachung, und der Arbeitgeber darf einen pauschalierenden und typisierenden Ansatz wählen und muss nicht auf die konkreten Verhältnisse des einzelnen Versorgungsberechtigten abstellen.
Ergo: Der Abzug von 72,36 Euro Kirchensteuer zur Ermittlung des fiktiven Nettoeinkommens bei der Berechnung der Zusatzversorgungsansprüche des Klägers erfolgt zu Recht.
… einem Vergleich
Die Klage wies das Gericht zwar ab, einen Vergleich gab es aber trotzdem – allerdings nur dergestalt, dass der Senat zur Begründung auf die Vergleichbarkeit mit der Ermittlung des Krankenversicherungsbeitrags verwies: Dieser erfolgt nach dem durchschnittlichen Beitragssatz der Ortskrankenkassen und damit ebenfalls unabhängig von den persönlichen Umständen; das sogar in Fällen, in denen überhaupt keine Versicherungspflicht bestand.
Eine solche Regelung genügt dem Gebot der Bestimmtheit und Normenklarheit und ist mit Art. 3 Abs. 1, Art. 4 Abs. 1 und Art.14 Abs.1 GG vereinbar. Eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung liegt daher nicht vor, stellt der Senat klar.
Fazit

Dirk Murski, Syndikus Recht und Steuern bei der Longial, betont in seinem Beitrag, dass der Senat im Rahmen seiner Abwägung den Interessen der Arbeitgeber an schlanken und entbürokratisierten Verwaltungsprozessen den Vorrang vor den Interessen der Arbeitnehmer einräumt, die ihren jeweiligen konkreten Einzelfall berücksichtigt wissen wollen.
Zwar werde das Versorgungsziel desto genauer erreicht, je mehr bei den gesetzlichen Abgaben auf den Einzelfall abgestellt wird – doch umso größer der hiermit verbundene Verwaltungsaufwand, so Murski: „Die Festlegung der vom Einzelfall losgelösten pauschalierenden Berechnung des fiktiven Nettoeinkommens soll eben den Verwaltungsaufwand für die Steuerpflicht begrenzen und damit zur Praktikabilität der Regelung beitragen, indem sie von der Abklärung individueller Umstände absieht.“
Das Urteil des Dritten Senats findet sich hier.