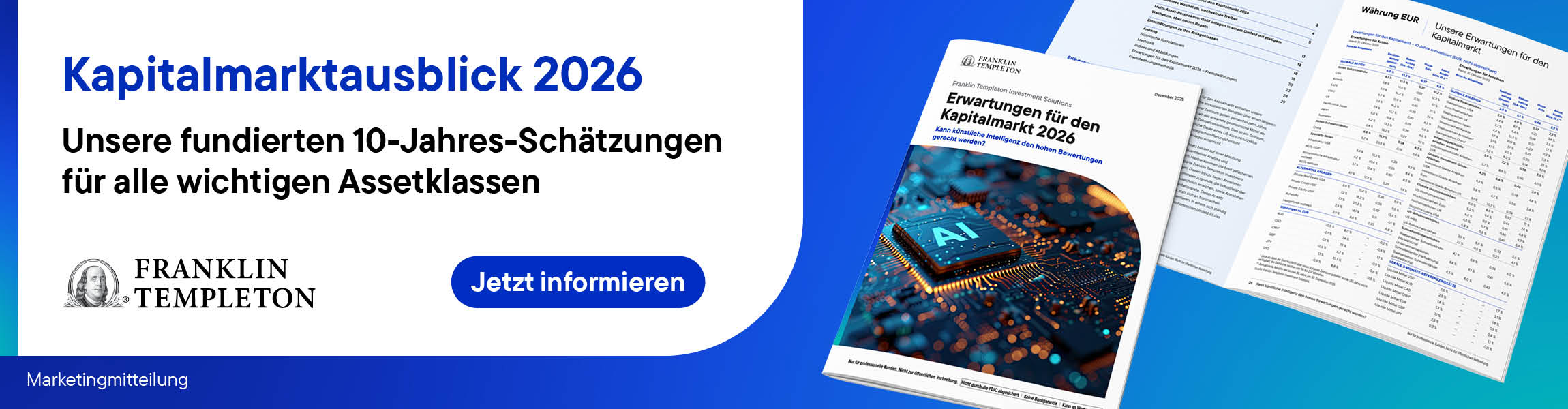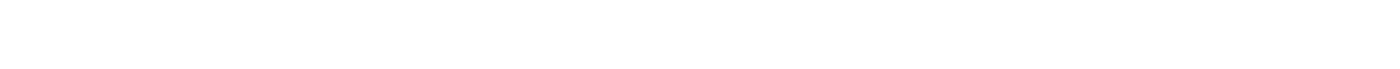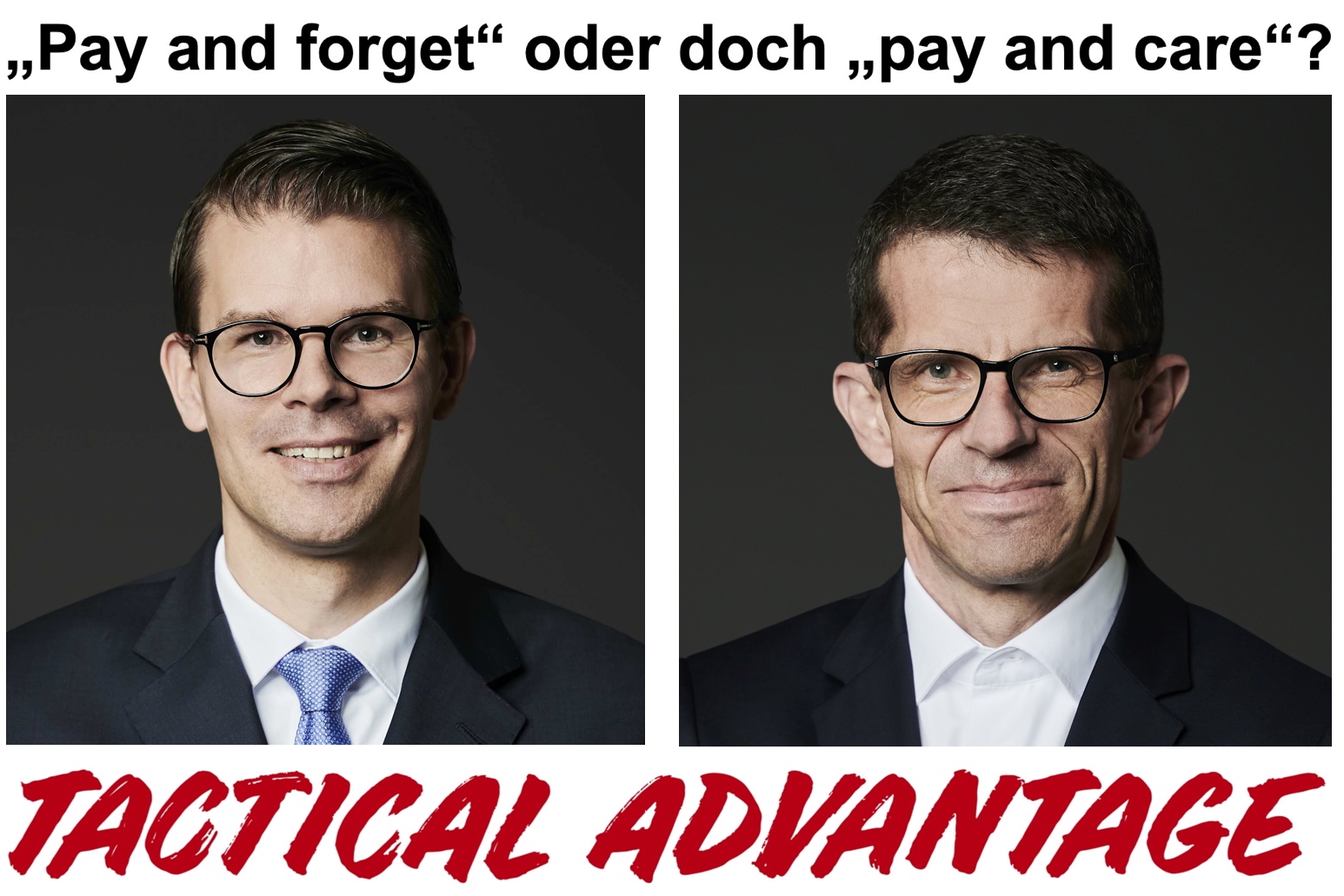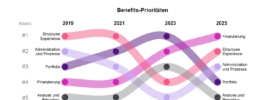Die lang erwarteten Ergebnisse der RG-Arbeitsgruppe in der aba-Fachvereinigung Mathe sind nun publiziert worden. Mit dem Papier sollte die Zukunft der Rentnergesellschaft nun ein paar Leitplanken erhalten. Das Lesen lohnt durchaus, doch hat PENSIONS●INDUSTRIES dies zum Anlass genommen, Sie, liebe Leserschaft, zu einem kleinen Experiment einzuladen.
Die beiden Aktuare Hanne Borst (WTW) und André Geilenkothen (Mercer) haben in der aktuelle Ausgabe 6 der BetrAV das lang erwartete Papier „Empfehlungen zur finanziellen Ausstattung von Rentnergesellschaften“ der aba-FV Mathematische Sachverständige (bzw. der dort angesiedelten Arbeitsgruppe zur Erarbeitung angemessener ökonomischer und versicherungsmathematischer Grundsätze für die finanzielle Ausstattung von Rentnergesellschaften in Deutschland) publiziert.

Der Text nimmt im effizienten Layout der aba-Zeitschrift 12,5 Seiten Layout ein, und ihn zu lesen lohnt.
Fünf Sekunden zur Executive Summary
Und nun zu dem kleinen, eingangs erwähnten Experiment: Die Redaktion hat den Text genommen und ChatGPT gebeten, eine für Sachkundige verständliche, nicht zu oberflächliche Zusammenfassung des Beitrages zu erstellen.

Dieser Text wird hier im Folgenden ganz bewusst ohne jedes redaktionelle Eingreifen publiziert. So kann sich jeder selbst ein Bild machen, wie gut und wie schlecht, wie richtig und wie fehlerhaft die KI auch solche sehr speziellen Sachverhalte mittlerweile analysieren kann. Übrigens ChatGPT benötigte hierfür weniger als eine Handvoll Sekunden. Und hier der unbearbeitete Text:
„Die Fachvereinigung Mathematische Sachverständige der aba hat erstmals umfassende Leitlinien zur ökonomisch und versicherungsmathematisch angemessenen Ausstattung von Rentnergesellschaften veröffentlicht. Anlass ist das wachsende Interesse an dieser Gestaltungsform, die es Unternehmen erlaubt, Pensionsverpflichtungen aus der Bilanz herauszulösen und rechtssicher auf eine eigenständige Gesellschaft zu übertragen.
Rentnergesellschaften: Nischenmodell mit wachsendem Potenzial
Rentnergesellschaften sind rechtlich selbstständige Gesellschaften, deren einziger Zweck darin besteht, Versorgungsverpflichtungen gegenüber ehemaligen Mitarbeitern zu erfüllen. Während diese Konstruktion in Deutschland seit Jahren möglich ist, rückt sie erst jetzt stärker in den Fokus. Gründe sind zum einen der Eintritt spezialisierter Anbieter, zum anderen der Wunsch vieler Unternehmen, langfristige Pensionsrisiken im Zuge von „De-Risking“-Strategien zu reduzieren. Anders als bei Treuhandlösungen oder Pensionsfonds kann eine Rentnergesellschaft – sofern sie sachgerecht ausgestattet wird – zur vollständigen Enthaftung des Arbeitgebers führen.
Rechtliche Grundlagen und BAG-Urteil
Zentraler Bezugspunkt bleibt ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2008. Es verlangt, dass eine Rentnergesellschaft bei realistischer Betrachtung dauerhaft in der Lage sein muss, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Vorsicht und Sorgfalt sind das Leitmotiv. Das BAG legte damals Maßstäbe für Rechnungszins, Sterbetafeln und Rentenanpassungen fest. Doch seither haben sich die Rahmenbedingungen deutlich verändert: Zinsniveau, Inflationsdynamik und internationale Rechnungslegung setzen neue Akzente. Genau hier setzt die Ausarbeitung der Aktuare an: Sie überträgt die Grundprinzipien in das heutige Umfeld und ergänzt sie durch moderne aktuariell-mathematische Methoden.
Empfehlungen im Detail
Die Arbeitsgruppe fordert, Rentnergesellschaften nach Best-Practice-Grundsätzen auszustatten:
Biometrie: Verwendung von Heubeck-Tafeln (RT 2018 G) oder ähnlichen bAV-spezifischen Modellen, ergänzt durch Sicherheitszuschläge. Kleine Bestände müssen entweder stärker gepuffert oder in größere Kollektive integriert werden.
Inflation: Prognosen dürfen sich nicht allein an der Vergangenheit orientieren, sondern müssen die EZB-Langfristziele sowie aktuelle Marktentwicklungen einbeziehen. Unterlassene Rentenanpassungen sind nachzuholen.
Rechnungszins: Starre Vorgaben wie die früher oft herangezogenen 3% sind nicht mehr zeitgemäß. Gefordert werden marktorientierte, vorsichtige Abzinsungen, die zugleich ein angemessenes Sicherheitsniveau gewährleisten.
Kapitalanlage und Governance: Klare Regeln zur Zweckbindung des Vermögens, zur Ausschüttung und zur Verwaltung sind unerlässlich. Empfohlen werden diversifizierte Portfolios, ggf. Treuhandmodelle (CTA) oder Asset-Pooling.
Wirtschaftliche und bilanzielle Implikationen
Neben rechtlichen Vorgaben hebt die Ausarbeitung die ökonomische Tragfähigkeit hervor. Unternehmen müssen sicherstellen, dass Rentnergesellschaften auch unter Stress-Szenarien – etwa bei anhaltender Inflation oder Marktschocks – liquide bleiben. Methodisch sind unterschiedliche Ansätze denkbar, von vorsichtigen Annahmen über pauschale Zuschläge bis hin zu stochastischen Simulationen.
Bilanzrechtlich spielt die Frage nach Settlement und Entkonsolidierung eine Rolle: Unter HGB und IFRS hängt die Ausbuchung von Pensionsverpflichtungen wesentlich von der Nachhaftung nach dem Umwandlungsgesetz ab. Garantiestrukturen oder Treuhandlösungen können entscheidend sein, um Bilanzentlastung zu erreichen.
Fazit: Chancen, aber auch offene Fragen
Die Empfehlungen der Fachvereinigung markieren einen wichtigen Schritt zur Professionalisierung von Rentnergesellschaften in Deutschland. Sie zeigen, wie Unternehmen durch eine vorsichtige Ausstattung und klare Governance Pensionslasten nachhaltig auslagern können – mit Vorteilen für Bilanz, Kapitalmarktkommunikation und Versorgungssicherheit.
Gleichwohl bleiben kritische Fragen: Ob sich Rentnergesellschaften im breiteren Markt durchsetzen, hängt von der Akzeptanz der vorgeschlagenen Standards und von der Bereitschaft der Unternehmen ab, substanzielle Mittel für eine robuste Erstdotierung bereitzustellen. Auch die langfristige Stabilität hängt von Faktoren ab, die außerhalb der Steuerung einer Gesellschaft liegen – etwa Kapitalmarktvolatilität, unerwartete Inflation oder künftige Rechtsprechung. Zudem bleibt offen, wie sich Investoren und Aufsicht positionieren und ob Versorgungsberechtigte Vertrauen in dieses Konstrukt entwickeln.
Sollten sich Rentnergesellschaften dennoch etablieren, könnten sie die deutsche bAV-Landschaft verändern: weg von der klassischen Arbeitgeberhaftung, hin zu eigenständigen Versorgungseinheiten mit professionellem Management. Damit wären sie ein Baustein, um die betriebliche Altersversorgung langfristig zu stabilisieren – aber nur, wenn die Balance zwischen ökonomischer Effizienz und Schutz der Berechtigten dauerhaft gewahrt bleibt.“
Soweit ChatGPT. Man darf sagen: Fünf Sekunden ist erstaunlich schnell, aber die Inhaltsdichte des Originals ist auch ungleich höher.